
Unter mein Huat
Gespräch mit dem Autor
Warum dieses Buch? Wie ist es entstanden?
Benedikter: Genau aus diesem Satz, nämlich „Do geaht schun nou a bissl“, oder „A bissl nou geaht olm“. Das drückt in einem Satz aus, was man landauf landab in Südtirol beobachten kann. Der Klimaplan ist zwar zur Kenntnis genommen worden, alle wissen, dass der Klimawandel im Gange ist, aber trotzdem setzt man überall noch auf Wachstum und Expansion. Wirtschaftswachstum geht aber nicht ohne zusätzlichen Energie- und Ressourceneinsatz.
Dieser Zusatzaufwand wird noch viele Jahre vorwiegend mit Energie aus fossilen Quellen gespeist, zudem ist die Energiewende selbst sehr ressourcenaufwändig. Man denke z.B. an die Heizungsumrüstung und die Elektromobilität. „Do geaht nou a bissl“ bedeutet auch: man will die Notwendigkeit des Zurückschaltens beim Wachstum nicht wahrhaben. Man glaubt, mit etwas Elektrifizierung bei Mobilität und Gebäudeheizung kann man den Klimawandel bewältigen und alles geht weiter wie bisher. Dem ist nicht so. Klimaneutralität bedeutet einen strukturellen und tiefgreifenden Wandel in unserem Umgang mit knappen Ressourcen.
Doch Südtirol hat einen Klimaplan?
Ja, seit Juli 2023 haben wir den Klimaplan 2040 mit klarem Ziel: Klimaneutralität bis 2040. Dort stehen 157 Maßnahmen, die z.T. schon umgesetzt werden. Wer durch Südtirol fährt, kann aber oft beobachten, wie unsere Wirtschaft weiter stark auf Wachstum setzt: viele Neubauten, Hotelerweiterungen, Skigebietserweiterungen. Es wird gerodet, planiert, versiegelt, als gäbe es den Klimaplan nicht, der unter anderem bis 2040 die Netto-Neuversiegelung des Bodens auf null bringen will. Neue Skipisten und Betten müssen dann gefüllt werden, das bringt mehr Mobilität, mehr Energieverbrauch, mehr Flächenversiegelung für die Bespaßungsanlagen. Es fragt sich also, ob der Klimaplan ernst genommen wird. Man hat beim Klimaschutz den Eindruck, es wird ein Schritt vor und gleichzeitig ein Schritt zurück gesetzt. Mit einer Maßnahme werden CO2-Emissionen reduziert, mit der anderen befeuert. Unterm Strich gibt's dann keine Netto-Einsparung.
Sie zitieren in Ihrem Buch auch Stimmen wie „Der Klimawandel betrifft uns eigentlich nicht“ oder „Den Klimawandel kann eigentlich keine kleine Region wie Südtirol lösen“.
Diese Haltung ist sehr verbreitet: die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Oder: das betrifft uns in Südtirol eigentlich nicht so stark. Oder: die Folgen des Klimawandels werden wir schon irgendwie bewältigen. Das ist falsch, denn die Erderhitzung betrifft den Alpenraum und die höheren Lagen sogar noch stärker. Die Folgen und die Kosten der Anpassung an den Klimawandel werden noch richtig teuer. Zum anderen gibt es die „räumliche Falle“, indem man die Verantwortung auf andere abschiebt. Doch für die Klimakrise sind immer noch die traditionellen Industrieländer quantitativ am stärksten verantwortlich, vor allem wenn man die kumulativen CO2-Emissionen betrachtet, also jene, die seit Beginn des Industriezeitalters in der Atmosphäre deponiert worden sind. Südtirol ist Teil eines Industrielandes und mit allen Regionen Italiens und Europas mitverantwortlich für den Klimaschutz. Wenn wir uns aus der weltweiten Mitverantwortung verabschieden und Hunderte andere Regionen dasselbe tun, kann man die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens vergessen. Dann platzt die planetare Solidarität, die beim Klimaschutz unverzichtbar ist.
Was bedeutet das, wenn wir nicht konsequent im Klimaschutz handeln?
Wir würden weiterhin viel mehr fossile Energie verbrauchen als nötig und vertretbar. Dadurch fließt auch viel Geld aus dem Land ab an die Energiekonzerne und an die Förderländer. Dieses Geld würde beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger zum Großteil im Land bleiben. Es würden weiterhin öffentliche Subventionsmittel in fossile Energieträger fließen, weil diese immer teurer werden und viele Familien Unterstützung bei den Energiekosten bräuchten. Es würde eine Chance vertan, uns rasch auf eine resilientere, also krisensichere Organisation der Unternehmen, der öffentlichen Infrastruktur und der privaten Haushalte umzustellen. Unterbliebener oder verzögerter Klimaschutz bedeutet im Klartext noch mehr Schäden und Kosten in der Zukunft.
Wie sollte Südtirol in Zukunft wachsen?
Leichter zu sagen wäre, was keinesfalls wachsen darf: das ist vor allem der Verbrauch fossiler Energie. Tut er aber, z.B. bei Benzin und Diesel für den steigenden Individual- und Güterverkehr, beim Kerosin für immer mehr Flugverkehr. Der Stromverbrauch wird wachsen, weil demnächst noch mehr elektrifiziert wird, in der Mobilität, Gebäudeheizung und industriellen Produktion. Der Gesamtenergieverbrauch sollte eigentlich nicht mehr wachsen, sondern sinken. Deshalb dürften wir energie- und ressourcenintensive Tätigkeiten nicht mehr fördern. Alles, was direkt mehr Verkehr und Bautätigkeit verursacht wie etwa zusätzliche Beherbergungskapazität und Zweitwohnungen, Massenevents und Straßenbauten, muss bei echtem Klimaschutz unterbleiben. Der motorisierte Individualverkehr muss laut Klimaplan und Mobilitätsplan schrumpfen, und zwar um 30% bis 2037. Damit muss man aber schon heute anfangen und nicht erst in 10 Jahren.
Heißt das auch, dass wir nicht weiterhin Boden verbrauchen dürfen?
Genau, denn damit entstehen Hitzeinseln, gehen CO2-Senken verloren, wird die Absorption von CO2 durch gesunde Böden noch geringer. Im Sinne des Klimaplans müssen wir den heutigen Umfang der Bodenversiegelung Jahr für Jahr herunterfahren und bis 2040 auf netto null ankommen. Das heißt, es darf auch nicht immer mehr Wald in Weideland umgewidmet werden. Was im Sinne des Klimaschutzes nicht weiterwachsen darf, sind Neubauten. Da wird immer sehr viel Beton verbraucht, und die Zementherstellung ist einer der größten Klimakiller. Nicht mehr weiter wachsen soll der gesamte Ressourcenverbrauch, weil wir heute schon zu hohen Materialverbrauch haben und eine zu geringe Recyclingquote.
Was sollte die Politik jetzt tun? Was erwarten Sie von der Landesregierung?
Von der nächsten Landesregierung ist zu erwarten, dass der Klimaplan 2040 umgesetzt wird, planmäßig und konsequent. Dafür muss er mit einem Landesklimaschutzgesetz noch verbindlicher festgeschrieben werden. Dann müssen zahlreiche Gesetze und Verordnungen folgen, um die Maßnahmen in Einzelbereichen zu regeln. Südtirol kann in Italien eine Vorreiterrolle einnehmen, sich am Beispiel vieler Regionen im Ausland orientieren. Für alle Sektoren sollte ein verpflichtender Reduktionspfad mit jährlichen Höchstmengen an Treibhausgasemissionen festgelegt werden. So etwa wird in Österreich beim neuen Bundes-Klimaschutzgesetz vorgegangen: es wird der Endenergieverbrauch pro Jahr und Sektor festgelegt wird, in der Folge werden Reduktionsziele bei den CO2-Emissionen für die Sektoren und Bundesländer festgeschrieben, also auch für jene Bereiche außerhalb des EU-Emissionshandels. Beispiel Heizungswende. In Österreich gibt es noch 1,9 Millionen fossil betriebene Heizungen, die bis 2040 zu ersetzen sind, wenn man klimaneutral werden will. Alle sanierungsbedürftigen Häuser sollen in diesem Zeitraum saniert werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen und die Förderungen geschaffen werden. Die Bundesländer müssen dann die jeweiligen Klimaschutzpläne und Klimaschutzgesetze erstellen. Dies sollte in Italien gleichermaßen erfolgen, aber wir hängen weit zurück.
Welchen Zweck hätte ein solches Klimaschutzgesetz?
Es soll einen Zielpfad für die jährliche Reduktion der CO2-Emissionen vorgeben, um bis 2040 Nullemission zu erreichen. Es soll auch Sektorenziele und Etappenziele vorgeben, z.B. bis 2030 -55%, wie von der EU gefordert. Das bedeutet im Klartext, dass Südtirol von heute rund 2 Millionen Tonnen CO2 auf maximal eine Million Tonnen runterfahren muss, und das bis 2030. Ein solches Gesetz würde klare Verbindlichkeit und langfristige Planbarkeit für die privaten Haushalte und die Unternehmen schaffen. Ein Plan kann dagegen von der Landesregierung von heute auf morgen abgeändert werden. Ein Landesklimaschutzgesetz würde neue Fördermaßnahmen für erneuerbare Energie schaffen, würde neue Instrumente und Kriterien für die Klimaverträglichkeit von Vorhaben einführen. Das Land könnte auch einen Klimacheck einführen, wie das Österreich getan hat. Die Landesregierung will laut Klimaplan bis Jahresende 2024 alle Landesgesetze und Landesförderungen auf ihre Klimarelevanz untersuchen. Das ist zu begrüßen.
Wo sehen Sie die größten Widersprüche?
Sehr krass beim Flugverkehr: SkyAlps will die Passagierzahlen verdreifachen, Flüge verdoppeln, Flugzeuge dazukaufen. Das alles steht im Gegensatz zum Klimaplan. Dort wird der Flugverkehr gar nicht einmal erwähnt. Fliegen ist und bleibt die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Große Widersprüche im Tourismus: immer noch wird die Beherbergungskapazität ausgebaut. Das bedeutet unvermeidlich mehr Ankünfte, mehr Nächtigungen, mehr Anreisen mit dem eigenen Fahrzeug. 93% der Südtirol-Urlauber kommen mit dem eigenen Fahrzeug. Ein Widerspruch auch beim Bauen, denn bis 2040 soll die Neuversiegelung netto auf null gesetzt werden. Widersprüche gibt‘s auch in der Mobilitätspolitik: immer mehr Bürger sollen auf den ÖPNV umsteigen, richtig so. Doch gleichzeitig wird Südtirol so massiv beworben, dass laufend zehntausende neue Besucher ins Land gelockt werden, die mit dem eigenen Auto anreisen. So hebt sich die Einsparung seitens der einheimischen PKW-Nutzer mit der zusätzlichen touristischen Mobilität auf. Auch die Viehhaltung zurückgefahren werden, weil sie den Großteil der 17% der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft ausmacht. Doch dafür ist in Südtirol nichts vorgesehen.
„La botte piena e la moglie ubriaca“: wird das das Leitmotiv in Südtirols Politik sein?
Dieser italienische Lehrsatz geht beim Wein nicht gut, noch weniger beim Klimaschutz. Zum einen soll weniger THG ausgestoßen werden, zum anderen sollen Güterexport, Tourismus und Transit-Güterverkehr auf der Straße doch wachsen. Zum einen soll der motorisierte Individualverkehr sinken, zum anderen will man mehr Ankünfte und Nächtigungen. Zum einen weniger Neuversiegelung, zum anderen mehr Baurechte für Bauern und Hoteliers. Zum einen Ausstieg aus der fossilen Energie, zum anderen Subventionierung von Dieseltreibstoff etwa für Frächter und Landwirte. Das alles klingt wie eine nicht ernstgemeinte Diät: auf der einen Seite spart das Land viele Emissionen ein, auf der anderen öffnet es die Türen für neuen Energieverbrauch, der sich noch lange aus fossiler Energie speist.
Mehr dazu in: Thomas Benedikter, Do geaht nou a bissl. Klimaschutz auf Südtirolerisch. Arcaedizioni
Lavis 2024, 13,00 Euro. Im Buchhandel.
UN-Klimakonferenz
Resultat der Sprachakrobatik der Regierungsvertreter ist, wie gewohnt, ein 21-seitiges Abschlussdokument mit Licht und Schatten. Zum ersten Mal ruft eine Klimakonferenz die Welt auf, sich von Kohle, Gas und Erdöl abzuwenden. Dies war zwar schon 1992 in Rio de Janeiro artikuliert worden, dennoch hat der globale CO2-Ausstoß 2022 mit 38,6 Mrd Tonnen sein Rekordhoch erreicht. UN-Klimachef Stiell sagte, noch steuere die Welt auf 3° Erderhitzung zu. Nichts steht im Dokument, dass keine neuen Kohlekraftwerke gebaut werden dürfen; nirgendwo werden alle Länder aufgefordert, 2025 den Höhepunkt der CO2-Emissionen zu erreichen; auch werden die Ölförderländer nicht verpflichtet, auf neue Explorations- und Förderprojekte zu verzichten.
Bis kurz vor Ende hatten sich einige Öl- und Gasförderländer dagegengestemmt, den Ausstieg aus der fossilen Energie festzuschreiben. Auch verständlich, denn damit würde man den Ländern mit der höchsten CO2-pro-Kopf-Emission die Geschäftsgrundlage entziehen. Sie würden sich wohl kaum an solche Erklärungen halten, sondern allenfalls auf einen weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Öl und Gas reagieren, um den Hahn zurückdrehen.
Warum reicht dieses Dokument nicht aus?
In der Abschlusserklärung der COP28 findet sich kein direkter Bezug zu den nationalen Beitragszusagen zur CO2-Emissionreduktion (NDC). Die famosen NDC von 2016 waren vor der UN-Klimakonferenz von Dubai evaluiert worden (stocktaking process) und hatten sich als bei weitem unzureichend entpuppt, um das 1,5° bzw. das 2°-Ziel bei der Erderhitzung einzuhalten. Die im Vorfeld der COP-28 evaluierten Zusagen für die NDC decken 95% der globalen Emissionen in 168 Staaten ab. Um das 2°-Ziel zu erreichen, dürften 2030 nicht mehr als 39 Mrd. t CO2 ausgestoßen werden. Doch auch wenn diese NDC-Zusagen der Regierungen realisiert würden – so Italy for Climate – würde man 2030 auf CO2-Gesamtemissionen zwischen 48 und 55 Mrd. t CO2 gelangen. Damit landet man eher bei 3° als bei 2° Erderhitzung. Das heißt, die Staaten müssten ihre nationalen Beitragzusagen (NDC) so rasch wie möglich neu und strenger formulieren und sich dann unter Anwendung von Sanktionen zur Umsetzung verpflichten. Das ist in Dubai nicht geschehen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Zudem weist die Abschlusserklärung von Dubai einige problematische Schlupflöcher auf wie etwa den Verweis auf Erdgas als Übergangslösung.
Private und staatliche Konzerne pumpen mehr als 1 Billion USD in neue Öl- und Gasförderung
Während 100.000 Menschen nach Dubai fliegen, um über die Klimapolitik zu diskutieren, pumpen private und staatliche Konzerne in vielen Ländern hunderte Milliarden an Neuinvestitionen in die fossilen Energieträger. Dazu gehört auch der Staatskonzern der VAE, den der Konferenzpräsident Al Jaber leitet. Wenige Wochen vor Beginn der COP28 hatte die ADNOC noch ein 16 Mrd. USD schweres Erdgasförderprojekt genehmigt. Würden all die geplanten Vorhaben realisiert, die Förder- und Raffinerieanlagen gebaut, würde dies die Fördermenge um 2% jährlich von 2020 bis 2030 erhöhen. 2030 hätte man eine weit höhere Fördermenge als mit dem 2°-Ziel vereinbar. Eigentlich hätte in der Abschlusserklärung von Dubai ein Investitionsstopp für Neuexplorationen und Erschließungen von Öl- und Gasvorkommen beschlossen werden müssen. Nur bestehende Anlagen könnten dann im phasing-out-Betrieb weiterlaufen. Die OPEC und andere erdölproduzierende Länder müssten mit immer weniger Einnahmen auskommen, die großen Ölkonzerne müssten einem systematischen und raschen Umbau unterworfen werden, die Finanzholdings müsste viel zügiger zum „divestment“ schreiten, zum Abzug der Finanzanlagen von Investitionen in den fossilen Bereich. All das fehlt im COP-Abschlussdokument.
Die Staaten hätten es in der Hand
Bei diesem Umbau der Öl- und Gasindustrie sitzen auch die Staaten selbst am Hebel, wie z.B. der zwölftgrößte Ölkonzern der Welt, die ADNOC der Vereinigten Arabischen Emirate, den der COP-28 Präsident Sultan al-Jaber leitet. Gut die Hälfte der globalen Öl- und Gasförderung erfolgt durch staatliche Ölgesellschaften, die 40% der Investitionen tätigen. Derzeit planen allein die nationalen Ölgesellschaften, bis 2030 400 Milliarden Dollar in Öl- und Gasprojekte zu investieren. Auch die USA unter Präsident Biden haben wieder neue Aufträge für Ölbohrungen in den USA vergeben, dass Deutschland als Kompensation zu den russischen Gaslieferungen mehr Kohle verstromt und Großbritannien neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee genehmigt hat.
Es geht um Projekte, die sich nur rentieren, wenn CO2-Emissionen weit über das 2°-Ziel hinaus freigesetzt werden. Entweder die Einhaltung der globalen Klimaziele oder die Amortisierung dieser Investitionen: beides gleichzeitig geht sich nicht aus. Zahlreiche staatliche Energiekonzerne schaffen das finanziell nur, weil sie von Regierungen massiv subventioniert werden. Damit unterlaufen diese Staaten systematisch die von ihnen mitunterzeichneten Pariser Klimaziele. Kein Wunder, denn es gibt noch keine verbindliche internationale Regulierung, die Investitionen in die Förderung von fossilen Energieträgern einschränkt oder verbietet. Richtigerweise hat die COP28 beschlossen, die Investitionen in die erneuerbare Energie zu verdreifachen. Doch wenn so gewaltiges Kapital in neue Förderung, Raffinerie und Transport von fossiler Energie gesteckt wird, bleiben naturgemäß für erneuerbare Energien viel weniger Mittel übrig. Auch hier zu wenig Konsequenz im Abschlussdokument von Dubai.
Nachfrageseite umso mehr gefordert
Trotz aller Bemühungen des größeren Teils der Signatarstaaten des Pariser Klimaabkommens von 2015 ist es nicht gelungen, in der Abschlusserklärung der 28. Klimakonferenz in Dubai den verpflichtenden Ausstieg aus den fossilen Energieträgern festzuschreiben. Nur „Abkehr“ von der fossilen Energie ist zu wenig: das bemängelte sogar der US-Vertreter John Kerry. Der zu erwartende Widerstand einiger Öl- und Gasförderländer hat diesen unumgänglichen Schritt verhindert. Umso mehr ist jetzt die Nachfrageseite, also die Verbraucher fossiler Energien in aller Welt, aufgerufen, die Exitstrategie aus der fossilen Energie konsequent weiterzutreiben. Alle Staaten und vor allem die Industriestaaten, zum Großteil Öl- und Gasimportländer, können als Nachfrager auf dem Weltmarkt die Fördermenge fossiler Energie wesentlich mitbestimmen, indem sie die Energiewende noch konsequenter verfolgen und ihren Import von Gas und Öl runterfahren. Die EU muss umso mehr an ihrem Zwischenziel von -55% CO2-Emissionen bis 2030 und an der Klimaneutralität bis 2050 festhalten. Die Industrieländer müssten zum einen die Energiewende beschleunigen, zum anderen eine Allianz mit den Schwellenländern bilden, damit nicht der globale Süden mit billigerem Öl und Gas dazu verführt wird, doch wieder auf die fossile Energie zu setzen. Für derartige Beschlüsse und Abschlusserklärungen sind wohl noch einige COPs abzuwarten, bevor größere Freudenfeste zum Durchbruch beim Klimaschutz angesetzt werden.
Thomas Benedikter
17.12.2023
Neue Landesregierung
An der Wahlurne hatte der Klimaschutz für die Südtiroler Wählerschaft keine große Dringlichkeit. Andere Themen haben sich mächtig ins Bewusstsein des Stimmvolks gedrängt. Auch für die jungen Wähler, die die Folgen der Erderhitzung weit stärker spüren werden, scheint der Klimaschutz nachrangig gewesen zu sein. Denn all jene Parteien, die in ihrem Wahlprogramm die anspruchsvollsten Aussagen zum Klimaschutz führten, haben an Sitzen verloren oder nichts dazugewonnen. Wieviel dagegen der italienischen Rechten am Klimaschutz liegt, lässt sich an der gesamtstaatlichen Politik beobachten. Dabei bremst die Lega in Rom wirksamen Klimaschutz deutlicher aus als die FdI, während in Südtirol ex-LR Vettorato (Lega) mit federführend beim Klimaplan war. Die Lega hat ihn abgesegnet. Konsequenz von SVP und Lega in dieser Hinsicht wird man auch daran messen können, ob die Anwendung des Klimaplans Teil des Koalitionsabkommens wird. Zudem wird der für Juni 2024 zu erwartende nationale Klimaschutzplan die Pflicht zur CO2-Emissionsreduktion allen Regionen und autonomen Provinzen vorschreiben. Wenn bis 2040 Klimaneutralität erreicht werden soll, warten auf die nächste Landesregierung eine Fülle von Maßnahmen und Entscheidungen. Hier drei Beispiele.
Ein sehr wirksamer Hebel zur Dekarbonisierung wäre eine CO2-Steuer, die in Europa von 10 Mitgliedsländern, noch nicht aber von Italien eingehoben wird. Während Österreich 2023 erst einen Satz von 35 Euro pro Tonne CO2 anwendet, liegt der CO2-Preis in der Schweiz schon bei 87 Euro pro Tonne CO2. Würde das Land Südtirol den Schweizer Satz übernehmen, könnte es jährlich 174 Millionen Euro einnehmen, dadurch die CO2-Emissionen senken und gleichzeitig einen „Heizungswendefonds“ speisen, der an Geringverdiener zinslose Kredite für den Heizungsaustausch ausschütten würde. Wiederum fehlt hier die Zuständigkeit, doch kann ein „Landesklimaschutz-Rotationsfonds“ auch aus anderen Quellen gespeist werden, wie z.B. aus einem Teil der PENSPLAN-Anlagen oder eben aus dem Landeshaushalt.
Dringend geboten auch die Einführung einer „Klimaverträglichkeitsprüfung“ für alle größeren Bauvorhaben und Erschließungsprojekte sowohl privater wie öffentlicher Träger. Wenn die neue Landesregierung Ernst macht mit dem Klimaplan, dürfen keine Projekte mehr zugelassen werden, die bei einer umfassenden CO22-Bilanz durchfallen, erhoben von einer unabhängigen Prüfstelle des Landes. Beispiel: 11 Millionen für eine Seilbahn, die quer durch den gerodeten Wald parallel zu einer Straße Touristen nach oben liftet, wie im Fall der Seilbahn Tiers-Frommer Alm geschehen, sind nicht nur hinausgeworfenes Steuergeld, sondern auch 11 Mio. weniger für echten Klimaschutz.
Thomas Benedkiker
9.12.2023
Als Kohlenstoffsenke (auch CO2-Senke) gilt ein natürliches Reservoir, das vorübergehend mehr Kohlenstoff aufnimmt und speichert, als es abgibt. Erst in jüngster Zeit sind Senken klimapolitisch relevant geworden, weil sie das menschengemachte CO2 aus der Atmosphäre absorbieren und die Erderhitzung etwas verlangsamen. Neben der wichtigsten Wenke, den Meeren, werden aber bisher wichtige Kohlenstoffsenken wie Wälder und Moore zunehmend zerstört (z.B. der Amazonas-Regenwald), während gleichzeitig Waldbrände und auftauender Permafrost in der Taiga gespeichertes CO2 in Massen frei geben. In Summe stellt der Sektor Landnutzung aktuell eine Nettosenke von 6,0 Gt CO2 dar, die vor allem auf die CO2-Absorption der Wälder zurückzuführen ist (vgl. Georg Niedrist, Emissionen der Südtiroler Landwirtschaft und Szenarien zur Erreichung der Klimaneutralität, EURAC 2022, 107).
Die in Südtirol vorhandenen CO2-Senken sind ziemlich überschaubar: lebende Biomasse (vor allem Wald), der Humus der Böden und Moore. Letztere bedecken weltweit 3% der Erdoberfläche, binden im Torf ein Drittel des gesamten terrestrischen Kohlenstoffs und rund das Doppelte des in Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs (vgl. Stefan Zerbe, Kein Platz für Torfabbau bei echtem Klimaschutz, in: Klimaland Südtirol? 2022, 74). Ein einziger Hektar Moor speichert schon 1000 Tonnen Kohlenstoff. Die Wiedervernässung von Mooren auf großer Fläche wäre enorm wichtig für den Klimaschutz. Allein in Südtirol sind nur mehr wenige Moore und Feuchtgebiete übriggeblieben, bis vor Kurzem ist im Unterland sogar noch Torf abgebaut worden.
Wie im übrigen Alpenraum wäre in Südtirol als terrestrische Senke für Kohlenstoff Wald noch reichlich vorhanden, die fast die Hälfte der Landesfläche einnimmt. In den borealen Nadelholzwäldern, also unseren Hochwäldern, steckt die Hälfte des CO2 im unterirdischen Pilzgeflecht. Allerdings nimmt die Speicherleistung des Waldes ab, sowohl wegen Übernutzung, also Holzeinschlag, als auch wegen dem Klimawandel selbst, man denke an Stürme wie Vaia, die 6000 ha Wald flachgelegt haben, und den Borkenkäferbefall. Beim typischen alpinen Nadelwald wird die CO2-Speicherung im Vergleich mit den CO2-Emissionen des Alpenraums als gering eingestuft (unter 10%).
Nun nimmt zwar die Waldfläche in Südtirol tendenziell zu, wie aus dem Agrar- und Forstbericht 2022 hervorgeht, aber zwischen Waldschäden und Rodungen ist nicht gesichert, ob auch die Senkenleistung der Wälder zunimmt. Aufforstungen wären angesagt, z.B. von aufgelassenen Almen, am besten von versiegelten Flächen. Allein in Südtirol wird im Zuge von Grün-Grün-Umwidmungen, von Bautätigkeit, der Neuanlage von Speicherbecken und Pistenerweiterungen immer noch viel Wald gerodet. Dies ist umso bedenklicher als auch die großen CO2-Senken des tropischen Regenwaldes laufend dezimiert werden, wozu die Fleischproduktion der Industrieländer (einschließlich Südtirol) wesentlich beiträgt.
Im Klimaplan Südtirol 2040 ist den CO2-Senken ein Aktionsfeld gewidmet (5.13 Klimaplan Südtirol 2040). Dieses erschöpft sich in der Einstellung des Abbaus von Torf. Es finden sich keine Maßnahmen zum Aufbau neuer Senken, zum Bodenschutz, zum rigorosen Schutz des Waldes. Dabei vergehen 100-150 Jahre, bis ein Wald wieder voll aufgebaut ist, etwa in den Vaia-geschädigten Gebieten. Der Wiederaufbau der Speicherkapazität braucht noch länger. Je mehr Holz man in den Wäldern lässt oder zumindest verbaut statt zu verbrennen, desto mehr CO2 bleibt gespeichert. Konsequenter Klimaschutz und großflächige Rodungen passen weder in den Alpen noch im tropischen Regenwald zusammen.
Wie steht es nun mit der sog. „Anrechenbarkeit“ der CO2-Senken? Darf ein Land oder eine Region seine CO2-Emissionen mit einer nachgewiesenen Senkenleistung seines Gebiets kompensieren? Laut Kyoto-Protokoll von 1997 war es möglich, sich CO2-Senken anrechnen zu lassen, sofern sie nachweislich auf menschliche Eingriffe nach 1990 zurückzuführen waren. Außerdem durften Kompensationsleistungen in Drittstaaten in bestimmtem Umfang dazugekauft werden (internationaler Handel mit Emissionszertifikaten) wie z.B. die Aufforstung von Wald im Ausland. Diese Art von Operation ist stark missbrauchsgefährdet.
Angesichts der Schwierigkeit, tatsächlich von Menschen neu geschaffene Senken von natürlichen Senken zu unterscheiden, wurde dann für jedes Land eine maximal anrechenbare Senkenleistung aus der Waldbewirtschaftung festgelegt. Der natürlich gewachsene Wald darf nicht als CO2-Senke angerechnet werden, weil es ihn schon gab und der Anstieg des CO2 in der Atmosphäre trotz dieser bestehenden Senken weitergeht. Auch der sich in Südtirol aufgrund höherer Temperaturen nach oben ausdehnende Wald ist paradoxerweise ein „Verdienst“ des Klimawandels, nicht des Menschen, darf also nicht angerechnet werden. Somit geht es nur um zusätzliche CO2-Senken, also wiedervernässte Moore, neu aufgeforstete Flächen, Bodenverbesserung durch andere Landnutzung von Kulturgrund. In diesem Sinn wäre es für den Klimaschutz wichtiger, auf weitere Rodungen zu verzichten, die Versiegelung tatsächlich zurückzuschrauben und mehr Pflanzen anzubauen, die viel CO2 binden.
CO2-Senken bilden langfristig keinen nachhaltigen Klimaschutz: in alten Wäldern nimmt die Senkenleistung ab; Stürme, Waldbrände und Borkenkäfer setzen viel CO2 frei, dann wird Wald sogar zur CO2-Quelle. Die Option Senken gibt uns lediglich etwas mehr Zeit, bis mit Energiesparmaßnahmen, erneuerbarer Energie und einer Abkehr vom mit fossiler Energie befeuerten Wirtschaftswachstum die CO2-Emissionen substanziell reduziert werden können. Der naturräumlich gegebene Wald ist ein Allgemeingut, kein Ersatz für echte Reduktion der Treibhausgasemissionen.
Thomas Benedikter
30.10.2023
Der Klimaschutz wird eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Landtags sein. Es geht vor allem um die Umsetzung des Klimaplans mit seinen immerhin 157 Maßnahmen, im Juli 2023 offiziell beschlossen. Der Klimaplan Südtirol 2040 – so noch-LH Kompatscher – ist eine politische Selbstverpflichtung, und war ein starkes Thema in einigen Wahlprogrammen, weshalb die Bürger im Regierungsprogramm 2023-2028 zu Recht seine Umsetzung beanspruchen können.
Andernfalls riskiert der Klimaplan zum zahnlosen Tiger zu werden, riskiert man die Erfahrung des alten Klimaplans von 2011 zu wiederholen. Doch dafür reicht die Zeit nicht mehr. Überdies muss der Klimaplan 2040 nachgeschärft werden, denn zahlreiche Maßnahmen sind noch vage und „soft“ (Konzepte, Arbeitsgruppen, Studien). Vor allem den Unternehmerverbänden ist es gelungen, Vieles im Klimapaket möglichst offen und flexibel zu halten. Weil der Klimaplan naturgemäß keine rechtliche Verbindlichkeit hat und seine Ziele von niemandem eingeklagt werden können, zeichnet sich jetzt ein mühseliges Tauziehen zwischen Politik und Interessenverbänden um jeden wirklich wirksamen Schritt zur CO2-Emissionsreduzierung ab. Ein Landesgesetz kann das ändern.
Klimaschutz verbindlich festschreiben
Der einzige Weg, dieses Planungswerk verbindlicher werden zu lassen und sich von vielen Bremsern auf dem Weg zur Klimaneutralität zu lösen, ist ein Klimaschutzgesetz. Erst wenn Ziele quantitativ beziffert werden, wenn CO2-Reduktionsverpflichtungen genau festgeschrieben werden, Verfahren verbindlich geregelt, Sektoren- und Etappenziele hin bis zur Klimaneutralität 2040 festgelegt werden, gewinnt der Klimaplan an Biss.
Südtirol ist dazu von staatlicher Seite nicht verpflichtet, doch die Landesautonomie erlaubt es dem Land, in seinen Zuständigkeiten den Weg für konsequenten Klimaschutz zu bahnen. Auch das Zusammenwirken für die CO2-Reduktionsmaßnahmen zwischen Regierung in Rom und Regionen ist noch nicht geregelt, denn im Unterschied zur Mehrheit der EU-Länder hat Italien noch kein Klimaschutzgesetz. Somit fehlen noch die klaren staatlichen Vorgaben für die Regionen im Klimaschutz. Dieses nationale Gesetz wird kommen und erste Entwürfe liegen schon im Parlament vor. Südtirol kann derweil mit gutem Beispiel vorausgehen, denn Klimaneutralität schon 2040 wird weder Rom allgemein festschreiben noch den Regionen vorschreiben, sondern EU-Vorgaben übernehmen (Klimaneutralität bis 2050). Südtirol braucht dieses Gesetz nicht abzuwarten, sondern kann seinem Anspruch, „Klimaland“ zu sein entsprechend, Klimaschutz in seinen autonomen Zuständigkeiten selbst weiterbringen.
Welchen Zweck hätte ein solches Gesetz?
Im Unterschied zum Klimaplan, eine Art Maßnahmenprogramm, setzt ein Gesetz einen verbindlichen Rahmen, der die Politik in den kommenden 16 Jahren in die Pflicht nimmt. Ein Landesgesetz schafft die nötige langfristige Verbindlichkeit und Planungssicherheit für die Politik, Unternehmen und Gesellschaft. In Deutschland haben aus diesem Grund schon 9 Bundesländer Klimaschutzgesetze mit quantitativen Klimazielen verabschiedet. Neben verbindlichen Zielen braucht es transparente Verfahren, ein systematisches Monitoring, unabhängige Überwachungsinstanzen, Änderungen bei der Vergabe öffentlicher Subventionen und Vergabepraxis, neue Verfahren zur Klimaverträglichkeitsprüfung von Großprojekten, Regelungen zum Klimaschutz in den Gemeinden und einiges mehr.
Welche Kernelemente sollte das Landesklimaschutz umfassen?
Vor allem muss ein quantifiziertes Minderungsziel (Klimaneutralität) festgelegt werden, das auch mehrere Zwischenziele vorsieht. Der Klimaplan, seine Umsetzung, seine regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung werden zur Aufgabe der Landesregierung. Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien wird damit zum öffentlichen Auftrag und gesetzlichen Pflicht. Neue Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien und zum Abbau der fossilen Energieverwendung müssen durch den Landtag. Dies erlaubt es der Landesregierung Durchführungsverordnungen zu Einzelbereichen des Klimaschutzes zu beschließen.
Das Klimaschutzgesetz setzt auch den Rahmen für eine klimaneutrale Landesverwaltung, für Maßnahmen im öffentlichen Gebäudebereich und bei den privaten Heizungen, bei der Mobilität und im öffentlichen Beschaffungswesen. Um diese Vorbildfunktion auch auf die Gemeinden auszudehnen, könnte das Land Fördermaßnahmen für Klimaschutz-Gemeinden ins Gesetz schreiben. Dort wird sich auch ein Mechanismus für das Monitoring und die Berichtspflichten finden, die alle 2-3 Jahre erfüllt werden müssen. Ein unabhängiges Expertengremium berät die Landesregierung, schlägt selbst Maßnahmen vor und überwacht die Berichtspflichten. Es muss sich um ein vom Landtag berufenes interdisziplinäres Wissenschaftlerkomitee handeln, das keiner Weisungsmacht untersteht.
Wenn die neue Landesregierung es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss ein solches Gesetz ganz oben auf die Agenda und ins Koalitionsprogramm, ganz unabhängig von ihrer Zusammensetzung. Denn Klimaneutralität ist bis 2040 gar nicht erreichbar, wenn nicht Ziele und Maßnahmen gesetzlich untermauert werden.
Thomas Benedikter
22.10.2023
In welcher Welt lebt Minister Salvini eigentlich, der gestern am Brenner für freie Fahrt für LKW demonstriert? 2022 haben 2,48 Mio. LKW den Brenner gequert, Tendenz steigend, 29,5% davon sind laut Mobilitätsplan 2035 Umwegverkehr. Der gesamte innere Alpenbogen (Fréjus bis Brenner) wurde 2021 von 5 Millionen schweren Strassengüterfahrzeugen gequert.
Der größere Teil davon benutzte die österreichischen Alpenübergänge. Allein 39,7 Mio. von insgesamt 72,5 Mio Tonnen (54,7%) Tonnen des Straßengüterverkehrs zwischen Frejus und Brenner hat die Brennerroute geschluckt. Bis 2040 soll das Verkehrsvolumen trotz Inbetriebnahme des BBT 2032 gemäß Südtiroler Mobilitätsplan um bloß 10,7% sinken. Damit wird die Brennerautobahn auf Jahrzehnte hinaus Mensch und Umwelt zwischen Kufstein und Verona belasten, wird der Haupttransitkanal der Alpen bleiben.
Auf der Brennerautobahn fährt ein gutes Drittel der 2,48 Millionen LKW (Fahrten im Jahr 2022) nicht den Bestweg, sondern einen Umweg bzw. Mehrweg. Das entspricht für 2019 880.000 LKW – so die alle 5 Jahre erscheinende CAFT-Erhebung, die eine um mehr als 60 km kürzere Alternativroute über einen anderen Alpenpass (vor allem Gotthard und Tauern) gehabt hätten. Nur 40% der Transit-LKW über den Brenner sind laut CAFT auf dem Bestweg unterwegs, während am Gotthard 97% des Schwerverkehrs auf der Straße den kürzesten Weg nimmt. Nebenbei war der Gotthard-Basistunnel (Bahn) im Jahr 2022 nur zu 62% ausgelastet und hätte all diese LKW aufnehmen können. Rund ein Fünftel aller Transit-LKW auf der Brennerroute fahren sogar mindestens 120 km länger, nur um einige Euro zu sparen.
Fast 53 Millionen umsonst gefahrene LKW-Kilometer: das ist ein Hohn auf das Prinzip der Kostenwahrheit. Es straft jene regierenden Politiker Lügen, die den Klimaschutz und „nachhaltige Mobilität“ als Priorität ausgeben. Es führt die EU selbst vor, die eine eigene „Strategie für intelligente und nachhaltige Mobilität“ verabschiedet hat, um die Klimaneutralität bis 2050 zu ermöglichen. Dabei würde es genügen, endlich die EU-Wegekostenrichtlinie ( (Wegekostenrichtlinie) (Eurovignette) anzuwenden. Im Klartext wären das eine deutliche Mauterhöhung. Dann aber auch: keine dritte Fahrspur Verona Nord-Bozen Süd, Nachtfahrverbot, sektorales Fahrverbot, Blockabfertigung, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h bei PKW, Euroklassen-Fahrverbot, mehr Kontrollen, Alpentransitbörse mit streng gedeckelter Jahreskontingent an LKW-Fahrten.
Eine sehr spürbare Mauterhöhung (auch für PKW) wird in Tirol angewandt, in Südtirol und im Trentino von den Landesregierungen viel zu wenig angemahnt. Dafür bräuchte es die Zustimmung von Deutschland und Italien, die derzeit weder Wissing noch Salvini geben würden. Solange die italienische Regierung willfährig Frächter- und Industrieinteressen zu Lasten von Gesundheit und Kima bedient, bleibt Klimaschutz eben reines Lippenbekenntnis; bleiben die Beteuerungen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene Nebelkerzen zur Beschwichtigung des Wahlvolks. Wenn die betroffenen Anrainer längs der A22 schon nicht aufbegehren, hätten sie in zwei Wochen zumindest an der Wahlurne eine Chance, ihre Unzufriedenheit zu zeigen.
Salvini polterte von wegen EU-rechtswidrigen Verkehrsbeschränkungen. Doch Umweg- statt Bestwegverkehr steht grundsätzlich in Widerspruch zu den Klimazielen und zur Mobilitätsstrategie der EU. Die EU hat im Klimagesetz vom 21.6.2021 die Reduktion der CO2-Emissionen um -55% bis 2030 festgelegt, Italien hat sich mit seinem Klimaplan PNIEC verpflichtet, bis 2030 die CO2-Emissionen um -40% zu reduzieren. Der Verkehr ist in Italien der einzige Bereich, in welchem die CO2-Emissionen seit 1990 nicht abgenommen, sondern bis 2022 um 10% zugenommen haben. 90% dieser Emissionen stammen aus dem Straßenverkehr. Wenn die Brennerroute nicht verteuert und reglementiert wird mit Priorität für die Auslastung der schon bestehenden Bahnkapazitäten, wird weder der Umwegverkehr noch der Gesamtverkehr auf der A22 sinken, weder die NO2-Belastung der Anrainer noch die CO2-Belastung des Klimas. Freie Fahrt für fossil betriebene LKW geht genau in die Gegenrichtung von Klimaschutz.
Nun ist es fast schon müßig, einen Minister, der extrem klimaschädliche Großprojekte in die Landschaft setzen will (Zement- und Stahlkoloss über die Meerenge von Messina) auf die klimaschädlichen Auswirkungen des Transit-Umwegverkehrs hinzuweisen. Doch überrascht die zögerliche Haltung von LH Kompatscher, der im Klimaplan die Reduzierung des LKW-Verkehrs festschreiben ließ. Immerhin macht der Verkehr auf der A22 allein schon 37% der gesamten CO2-Emissionen aus dem Verkehr in Südtirol aus. Dort, wo ein voller Schulterschluss mit dem Tiroler Landtag gefragt wäre, der einstimmig die Maßnahmen zur Beschränkung des LKW-Transitverkehrs unterstützt, schlägt er eine „Vermittlung“ zwischen Salvini und den Tirolern vor. Ganz so als wären die Tiroler zu weit gegangen, als wären die Anrainer im Wipp- und Eisacktal, in Bozen und im Unterland nur Zuschauer, nicht Opfer.
Thomas Benedikter
10.10.2023
Der Klimawandel ist bei der DOLOMITEN-Podiumsdiskussion vom 26.9.2023 in Brixen vom Publikum zum Top-Thema erkoren worden (29% der Teilnehmenden), noch vor den niedrigen Löhnen (16%) und der Gesundheitspolitik (17%). Alle Parteien hätten sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben – so die DOLOMITEN in ihrem Bericht vom 4.10.2023 – doch die politischen Vorschläge dazu fallen sehr unterschiedlich aus. Zwischen jenen, die die SVP mit dem Klimaplan 2040 auf dem richtigen Weg sehen (Amhof, SVP), jenen die „die grüne Verbotspolitik“ ablehnen (Stauder, Freiheitliche), jenen, die den Chinesen die Schuld für den Klimawandel zuschreiben, während Südtirol ohnehin für Klimaschutz zu klein sei (Bova, FdI) und jenen, die der Politik vorwerfen, zu lange geschlafen zu haben (Mussner GRÜNEN) und Mahlknecht (Team K) liegen Welten.
Klimaschutz in der Wahlumfrage des SJR
Deutlicher werden die Positionen in der Wahlhilfe für Jugendliche des Südtiroler Jugendrings. Plakativ sprechen sich hier fast alle befragten Spitzenexponenten in den Express-Statements für aktiven Klimaschutz aus, aber eben nur in aller Kürze. Sollen sich Jugendliche tatsächlich daraus ein Bild machen können?
LH Kompatscher verweist auf den Klimaplan mit den 157 Maßnahmen. Die Grundausrichtung sei: wir müssen viel tun und schnell tun, und dabei aufpassen, dass dies sozialverträglich bleibt. Klimaschutz nicht nur für jene, die sich einen Tesla leisten könnten. Das Tourismusangebot soll nicht gedeckelt, sondern anders gestaltet werden. Zur Gratisnutzung des ÖPNV sagt Kompatscher als einer der wenigen nein, weil dann die Leistungen des ÖPNV nicht mehr ausgebaut werden könnten.
Bessone von der LEGA bleibt sehr oberflächlich: für den Klimaschutz sei halt Energie zu sparen. Auch die Jugendlichen seien da nicht so sparsam, wie nötig. Alle müssten mit ihrem konkreten Verhalten einen Beitrag leisten.
Thomas Widmann will für den Klimaschutz alle fossilen Brennstoffe mit erneuerbarer Energie ersetzen. Es gebe unendlich viel Wasserkraft in Südtirol, man müsse in innovative Technologie investieren. Die Verkehrsgewohnheiten sollten sich vollkommen ändern. So spricht sich Widmann für den kostenlosen ÖPNV für alle aus. Er werde sich für den Ausbau der Wasserstofftechnologie einsetzen.
Renate Holzeisen (Liste VITA) meint: „Wir stehen für den Umweltschutz, aber nicht für Klimahysterie. Was als vom Menschen verursachter Klimawandel betrachtet wird, ist absolut zu hinterfragen.“ Die Klimawandelthesen würden weltweit von renommierten Wissenschaftlern beanstandet. Holzeisen profiliert sich damit als eine der wenigen Klimawandelleugnerinnen unter den Kandidatinnen.
Auch Wirth-Anderlan (JWA) ist gegen die „Klimahysterie“, schließlich hätten wir in der Geschichte ja auch schon Eiszeiten gehabt. Südtirol sei dafür schon gut aufgestellt. Beim Tourismus ist der stramme ex-Schützenchef gegen jede Erhöhung, für die Gratisnutzung des ÖPNV, für einen Bettenstopp. Das Wichtigste zum Schluss: „Sich nicht von links-grünen Lehrpersonen erziehen lassen.“
Laut Sven Knoll (Südtiroler Freiheit) soll zwecks Klimaschutz der Verkehr reduziert werden und das Projekt Reschenbahn weiter betrieben werden. Man sollte viel mehr in die Schiene investieren. Das Tourismusangebot sollte nicht erweitert, sondern nur mehr „verbessert“ werden.
Für Repetto (PD) sollten die Menschen zuallererst verstehen, dass der Klimawandel schon im Gange sei. Man müsse auf globaler Ebene dagegen vorgehen und die CO2-Emissionen reduzieren. Dafür müsse man vor allem auf kultureller Ebene mehr tun. Na immerhin.
Fratelli d’Italia sprechen sich frohgemut für den Ausbau des Tourismus aus. Auch der ÖPNV solle für alle gratis sein. Beim Klimaschutz brauche es einen Kulturwandel, alle sollten etwas mehr auf die „cultura ambientale“ achten, und vor allem die Fallen des „green washing“ vermeiden. Was er wohl damit meint?
Jacopo Cosenza (M5S) spricht sich gegen mehr Tourismus und für einen kostenlosen ÖPNV aus. Der Klimawandel werfe soziale und ökologische Probleme auf. In Südtirol sei auch an die Folgen des Klimawandels für die Berggebiete zu denken. Die CO2-Emissionen seien nicht nachhaltig, der Verkehr müsse dringend reduziert werden.
Unterholzner (ENZIAN) hat zum Klimawandel eine klare Meinung: Wir in Südtirol könnten nicht das Weltklima verändern. Wir sollten Südtirol, so wie es heute ist, zu erhalten versuchen. Jeder solle seinen Beitrag leisten, aber nicht – wie jetzt von der EU beschlossen – indem die Verbrennermotoren ab 2035 verboten werden. Hier werde etwas kaputt gemacht, was unsere Generation in den letzten 50-60 Jahren mühsam aufgebaut habe. Da sollte man vorsichtig sein.“ Wer hätte vom ehemaligen Autozulieferer-Betriebschef Unterholzner was anderes erwartet?
Brigitte Foppa von den GRÜNEN begrüßt es, dass der Klimaschutz endlich auf die politische Agenda gekommen sei. Klima- und Umweltschutz sei für die GRÜNEN längst schon Thema und Priorität, als sich noch niemand dafür interessiert habe. Beim Heizen müsse man für den Umstieg auf erneuerbare Energie und für Wärmedämmung sorgen, doch alle Haushalte sollten dabei gefördert werden. Junge Menschen sollten sich bewusster ernähren.
Luca di Biasio (Die Linke) fordert, dass endlich alle den Klimawandel endlich ernst nehmen, denn es gebe immer noch Menschen, die ihn leugnen. Dann sollte auf der Ebene der Industrieproduktion, des Verkehrs, der Gebäudeheizung und bei der Ernährung eingegriffen werden.
Giada Del Marco vom Team K spricht sich dafür aus, die schadstofffreien Energiequellen zu fördern in allen Bereichen.
Sabine Zoderer von den Freiheitlichen meint, dass man gegen den Klimawandel aktiver werden müsse, aber nicht mit Verboten. Verbote bestrafen die Menschen. Auch die Benziner-PKW sollten noch ihren Platz haben. Das Tourismusangebot erweitern? Auf keinen Fall, sagt Zoderer, es gäbe jetzt schon overtourism mit allen Folgen für die Wohnungspreise und Lebenshaltungskosten. Doch auf der anderen Seite dürften die Zweitwohnungsbesitzer nicht bestraft werden.
Der Klimaschutz in den Wahlprogrammen
Ja, es gibt sie noch und sie haben auch Aussagekraft: Wahlprogramme. Die wenigsten Wähler:innen scheinen diese Programme zu konsultieren, entsprechend dünn fallen sie bei manchen Listen aus oder fehlen komplett (Südtiroler Freiheit, VITA, mehrere italienische Parteien wie die Lega). Im Unterschied zur demokratieerfahrenen Schweiz müssen die wahlwerbenden Parteien gar kein Minimal-Programm vorlegen. Der Landtag bringt dementsprechend auch keine Auflistung der Programmpunkte auf seiner Webseite ganz zu schweigen von einer postalischen Zustellung einer Wahlbroschüre an alle Wahlberechtigten. Mit Transparenz will man es in Südtirol auch nicht übertreiben!
Der Klimaschutz im SVP-Programm
Das Wahlprogramm der SVP bringt im Teil II (Unsere Maßnahmen von A bis Z) einige Kernaussagen zur Energiepolitik: „Der schrittweise Umbau unseres auf fossilen Energieträgern aufbauenden, Wirtschaftssystems in Richtung Dekarbonisierung stellt eine Herausforderung dar. Dabei spielt insbesondere die Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energieträger (Photovoltaik und Windenergie) sowie eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in einer bewirtschafteten Kulturlandschaft eine zentrale Rolle. Durch die erweiterten Möglichkeiten, Photovoltaikpaneele und Sonnenkollektoren auf Gebäuden anzubringen, wird nicht nur die alternative Energieerzeugung vorangetrieben, sondern werden auch bereits versiegelte Flächen werden bestmöglich genutzt.“
Bei Natur- und Landschaftsschutz beruhigt die SVP die Gemüter: „Südtirol bleibt grün. Wir haben im Klimaplan eine nachhaltige und umweltverträgliche Strategie festgeschrieben, die auch künftig ein „grünes Südtirol“ gewährleistet.“
Als oberste Priorität sind darin Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduktion des CO2-Ausstoßes, zur Förderung der erneuerbaren Energien sowie insgesamt zu einer „grünen Energieproduktion“ vorgesehen. Unser Konzept für ein effektives Biodiversitätsmonitoring kann man als Vorreitermodell im mitteleuropäischen Raum bezeichnen. Wir sehen Schutzmaßnahmen für die Umwelt in einem breiten Kontext. So wollen wir beispielsweise verstärkt auf E-Mobilität bzw. „green mobility“ setzen, in der Abfallwirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft hinarbeiten oder die NO2-
Konzentration in der Luft senken. Unser politisches Ziel ist es, zukünftig weitere autonomierechtliche Zuständigkeiten im Umweltbereich zu erhalten.
Im Kapitel Wirtschaft findet man auch das: „Wir setzen beim Wirtschaftswachstum auf Qualität und nicht auf Quantität – deshalb werden Unternehmen gefördert, die schonend mit Ressourcen umgehen und im Einklang mit historisch gewachsenen Kontexten wirtschaften. Der Mehrwert definiert sich dabei nicht nur durch unmittelbare Wertschöpfung, sondern orientiert sich unter anderem auch am Gemeinwohlprinzip. Öffentliche Unterstützungen tragen zu mehr Familienfreundlichkeit bei und verfestigen die lokalen Kreisläufe.“
Interessant wird es beim Stichwort „Tourismus“. Die SVP will hier neue Märkte eröffnen und die Bewerbung Südtirols verbessern. Beim Mengenwachstum (sprich Ankünfte und Nächtigungen) will man „mit Bedacht vorgehen“. Das Landestourismusentwicklungskonzept 30+ soll systematisch umgesetzt werden. Was die Lobbys erfolgreich aus dem Programm bugsiert haben, ist der Bettenstopp, der mit keinem Wort erwähnt wird.
Auch beim Verkehr will die SVP das eine und das andere: den ÖPNV stärken und ins kapillare Straßennetz investieren. Beim Schwerverkehr gedenkt die SVP, den Personenverkehr und Warenverkehr auf die Schiene zu verlagern, den Brennerkorridor zu digitalisieren und den Ausweichverkehr auf der Staatsstraße zu unterbinden. Kein Wort allerdings zur Senkung des Umwegverkehrs auf der A22; kein Wort zur Unterstützung der Maßnahmen gegen den übermäßigen Schwerlastverkehr auf der Autobahn des Bundeslands Tirol.
Wo die Kompetenz auch aus dem Programm spricht: Die Grünen
Das Wahlprogramm der Grünen ist da erwartungsgemäß ausführlicher. Im Kap. 2.3 gehen die GRÜNEN darauf ein, „wie wir die Energiewende schaffen - Die fossile Vergangenheit durch eine erneuerbare Zukunft eintauschen“. Die GRÜNEN sehen „die Eindämmung der Klimakrise als größte Herausforderung unserer Zeit.“ Hier der Text: „Der Umbau unseres Energiesystems hin zu den Erneuerbaren Energien ist keine leichte Aufgabe, andererseits birgt er für Südtirol auch riesige Chancen. Wir haben die Möglichkeit, in der Energieproduktion unabhängig zu werden. Südtirol hat die idealen Voraussetzungen dafür. Vereinbarkeit von Energiewende, Landschafts- und Umweltschutz, Bekämpfung von Energiearmut, Partizipation, Akzeptanz und Gerechtigkeit und vor allem die soziale Abfederung sollen das Zentrum unserer Bürger-Energiewende bilden. Dafür braucht es verbindliche Zielsetzungen, eine sichere und angemessene Finanzierung, ein effizientes Management und das Mitwirken aller Bürger:innen und Institutionen.“
Die GRÜNEN sind für:
1) Energieeinsparung und effiziente Nutzung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
2) Erneuerbare Energien und die damit verbundenen Infrastrukturen in der notwendigen Menge ausbauen.
3) Genehmigungsverfahren stark beschleunigen: Beim Ausbau von erneuerbaren Energien den Faktor Zeit mitberücksichtigen.
Die GRÜNEN schlagen vor:
Die Klimawende müsse aber leistbar für alle sein, unterstreichen die GRÜNEN (Punkt 2.4), denn nur „eine leistbare Klimawende ist eine gelingende Klimawende.“ Die Erderwärmung ist Tatsache und bereits jetzt nicht mehr aufzuhalten. Um die Folgen in einem möglichst erträglichen Maß zu halten, brauche es eine radikale Wende und drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Treibhausgase auf allen Ebenen. Die Umstellung auf klimafreundliche Fortbewegungsmittel, weniger belastende Lebensmittelproduktion und Wohnformen bringe Kosten mit sich. Diese dürfen nicht auf die einzelne Familie, den einzelnen Haushalt abgewälzt werden, sondern müssten in die öffentlichen Haushalte eingerechnet werden. Die Klimawende müsse für alle leistbar sein. Ansonsten wird es erstens Widerstand geben, und zweitens bleibt sie auf eine Elite begrenzt. Nur eine leistbare Klimawende sei eine gelingende Klimawende.
Starke Bedeutung für den Klimaschutz haben auch die Vorschläge in den Bereichen Natur-, Landschafts- und Artenschutz (Punkt 1.1), Grüne Landwirtschaft (Punkt 1.2) und Ernährung (1.5). Keine andere Partei bringt eine solch ausführliche Liste konkreter Vorschläge zum Klimaschutz, keine andere Liste bringt einen derart artikuliertes und zielführendes Maßnahmenprogramm für die Landespolitik wie die GRÜNEN. Wer hätte es auch anders erwartet?
Das Gegenteil davon bietet die Liste VITA, die auf ein Wahlprogramm im engen Sinn komplett verzichtet (zumindest nichts im Internet zu finden) und bei den Statements der Listenführerin (Holzeisen), die den Klimawandel als solchen in Frage stellt. VITA ist damit die einzige Kraft, die sich als Klimawandelleugnerin zu profilieren versucht.
Was schreibt das Team K in sein Wahlprogramm zum Thema Klimaschutz?
Das Team K setzt in seinem Wahlprogramm die Priorität auf den Ausbau der Schiene und des ÖPNV. Das Land müsse sich beim Ausbau von Straßen, bei Umfahrungen und Kreisverkehren, auf landschafts- ressourcen- und umweltschonende Varianten beschränken und die Bevölkerung einbeziehen. Weitere Punkte liegen dem Team K am Herzen:
ENZIAN: Die Klimapolitik ist eine „Planwirtschaft“
Das meint die Gruppe ENZIAN, die es gerne neoliberal hat. Unter „Wirtschaft und Soziales“ bringt es die Unterholzner-Partei so auf den Punkt: „Wirtschaft und Soziales, als Teilbereiche der gesamten Gesellschaft, sowie Umwelt, dürfen nicht in Konkurrenz zueinanderstehen. Eine gesunde Wirtschaft ist Voraussetzung, Sozialleistungen anbieten zu können; eine Gesellschaft, der es gut geht, ist Voraussetzung für eine gesunde Wirtschaft und einer Gesellschaft in demographischem Gleichgewicht. Politik, welche sich auf die eine Seite schlägt, bringt das System aus dem Gleichgewicht und führt zum Wohlfahrtsverlust der gesamten Gesellschaft. Die aktuelle vorangetriebene Klimapolitik wird, wie alle Planwirtschaften der Vergangenheit, ein Irrweg sein, meint ENZIAN. Diese planwirtschaftliche Klimapolitik sei unzweckmäßig, da sie das vorgegebene Ziel („Klimarettung“) nicht erreichen werde, allerdings die heimische Wirtschaft und Gesellschaft mit zusätzlichen Auflagen und Kosten treffen werde, was zu einer weiteren Inflation sowie der Verarmung des Mittelstandes führen wird; „Diese Klimapolitik ist keine echte Umweltschutzpolitik und wird deshalb von uns, Enzian, in keine Art und Weise unterstützt, zudem verfehlt sie das vorgegebene Ziel des Klimaschutzes, bzw. der CO2 Reduktion und führt und führt zu einer Verarmung der Bevölkerung.“
Freiheitliche: Klimaschutz durch billigeren Strom für alle
Beim Wahlprogramm der Freiheitlichen steht in Sachen Umwelt ganz oben: „Günstiger Strom für alle“. Die ganze Bevölkerung soll von Südtirols Energiereichtum profitieren und erneuerbare Energie zu tieferen Preisen als bisher erhalten. Das soll die „Strom-Autonomie“ bewerkstelligen. Das Land soll die auf dem Autonomiestatut beruhende Pflicht, Gratisstrom an die Haushalte weiterzugeben, einlösen und überhaupt beim Strom eine eigene Tarifzone einrichten. Offen bleibt die Frage, inwiefern billiger Strom für alle dem aktiven Klimaschutz und dem Energiesparen weiterhilft.
Die Freiheitlichen wollen nicht nur die Fotovoltaik und Wasserkraft für die Stromerzeugung stärker nutzen, sondern auch das Windkraftpotenzial durch „Klein-Windturbinen“ ausschöpfen. Für die Installation von PV-Anlagen auf dem eigenen Dach soll es mehr Landesförderung geben.
Ansonsten sei der Klimaplan 2040 grundlegend zu überarbeiten, meinen die Freiheitlichen. Hier sei eine Vielzahl an übereifrigen und undurchdachten Maßnahmen versammelt. Dazu gehören laut Freiheitlichen auch das Verbot von Ölheizungen in Neubauten, die einen Eingriff ins Eigentum und eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Bürger mit sich brächten. Also mehr „Freiheit beim Heizen“ und „Zurück zu den fossilen Brennstoffen“. Das ist es wohl, was die Freiheitlichen meinen, wenn es da lautet: „Vernunftbasierter statt ideologisierter Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.“
Für eine Überraschung gut ist die Südtiroler Freiheit, die auf ihrer Website kein Wahlprogramm bringt. Vielleicht sorgt aus ihrer Sicht die Landeseinheit alleine schon für besseres Klima!
Thomas Benedikter
5.10.2023
„Do geaht nou a bissl“
Klimaschutz auf SüdtirolerischWarum dieses Buch? Wie ist es entstanden?
Benedikter: Genau aus diesem Satz, nämlich „Do geaht schun nou a bissl“, oder „A bissl nou geaht olm“. Das drückt in einem Satz aus, was man landauf landab in Südtirol beobachten kann. Der Klimaplan ist zwar zur Kenntnis genommen worden, alle wissen, dass der Klimawandel im Gange ist, aber trotzdem setzt man überall noch auf Wachstum und Expansion. Wirtschaftswachstum geht aber nicht ohne zusätzlichen Energie- und Ressourceneinsatz.
Dieser Zusatzaufwand wird noch viele Jahre vorwiegend mit Energie aus fossilen Quellen gespeist, zudem ist die Energiewende selbst sehr ressourcenaufwändig. Man denke z.B. an die Heizungsumrüstung und die Elektromobilität. „Do geaht nou a bissl“ bedeutet auch: man will die Notwendigkeit des Zurückschaltens beim Wachstum nicht wahrhaben. Man glaubt, mit etwas Elektrifizierung bei Mobilität und Gebäudeheizung kann man den Klimawandel bewältigen und alles geht weiter wie bisher. Dem ist nicht so. Klimaneutralität bedeutet einen strukturellen und tiefgreifenden Wandel in unserem Umgang mit knappen Ressourcen.
Doch Südtirol hat einen Klimaplan?
Ja, seit Juli 2023 haben wir den Klimaplan 2040 mit klarem Ziel: Klimaneutralität bis 2040. Dort stehen 157 Maßnahmen, die z.T. schon umgesetzt werden. Wer durch Südtirol fährt, kann aber oft beobachten, wie unsere Wirtschaft weiter stark auf Wachstum setzt: viele Neubauten, Hotelerweiterungen, Skigebietserweiterungen. Es wird gerodet, planiert, versiegelt, als gäbe es den Klimaplan nicht, der unter anderem bis 2040 die Netto-Neuversiegelung des Bodens auf null bringen will. Neue Skipisten und Betten müssen dann gefüllt werden, das bringt mehr Mobilität, mehr Energieverbrauch, mehr Flächenversiegelung für die Bespaßungsanlagen. Es fragt sich also, ob der Klimaplan ernst genommen wird. Man hat beim Klimaschutz den Eindruck, es wird ein Schritt vor und gleichzeitig ein Schritt zurück gesetzt. Mit einer Maßnahme werden CO2-Emissionen reduziert, mit der anderen befeuert. Unterm Strich gibt's dann keine Netto-Einsparung.
Sie zitieren in Ihrem Buch auch Stimmen wie „Der Klimawandel betrifft uns eigentlich nicht“ oder „Den Klimawandel kann eigentlich keine kleine Region wie Südtirol lösen“.
Diese Haltung ist sehr verbreitet: die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Oder: das betrifft uns in Südtirol eigentlich nicht so stark. Oder: die Folgen des Klimawandels werden wir schon irgendwie bewältigen. Das ist falsch, denn die Erderhitzung betrifft den Alpenraum und die höheren Lagen sogar noch stärker. Die Folgen und die Kosten der Anpassung an den Klimawandel werden noch richtig teuer. Zum anderen gibt es die „räumliche Falle“, indem man die Verantwortung auf andere abschiebt. Doch für die Klimakrise sind immer noch die traditionellen Industrieländer quantitativ am stärksten verantwortlich, vor allem wenn man die kumulativen CO2-Emissionen betrachtet, also jene, die seit Beginn des Industriezeitalters in der Atmosphäre deponiert worden sind. Südtirol ist Teil eines Industrielandes und mit allen Regionen Italiens und Europas mitverantwortlich für den Klimaschutz. Wenn wir uns aus der weltweiten Mitverantwortung verabschieden und Hunderte andere Regionen dasselbe tun, kann man die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens vergessen. Dann platzt die planetare Solidarität, die beim Klimaschutz unverzichtbar ist.
Was bedeutet das, wenn wir nicht konsequent im Klimaschutz handeln?
Wir würden weiterhin viel mehr fossile Energie verbrauchen als nötig und vertretbar. Dadurch fließt auch viel Geld aus dem Land ab an die Energiekonzerne und an die Förderländer. Dieses Geld würde beim Ausbau der erneuerbaren Energieträger zum Großteil im Land bleiben. Es würden weiterhin öffentliche Subventionsmittel in fossile Energieträger fließen, weil diese immer teurer werden und viele Familien Unterstützung bei den Energiekosten bräuchten. Es würde eine Chance vertan, uns rasch auf eine resilientere, also krisensichere Organisation der Unternehmen, der öffentlichen Infrastruktur und der privaten Haushalte umzustellen. Unterbliebener oder verzögerter Klimaschutz bedeutet im Klartext noch mehr Schäden und Kosten in der Zukunft.
Wie sollte Südtirol in Zukunft wachsen?
Leichter zu sagen wäre, was keinesfalls wachsen darf: das ist vor allem der Verbrauch fossiler Energie. Tut er aber, z.B. bei Benzin und Diesel für den steigenden Individual- und Güterverkehr, beim Kerosin für immer mehr Flugverkehr. Der Stromverbrauch wird wachsen, weil demnächst noch mehr elektrifiziert wird, in der Mobilität, Gebäudeheizung und industriellen Produktion. Der Gesamtenergieverbrauch sollte eigentlich nicht mehr wachsen, sondern sinken. Deshalb dürften wir energie- und ressourcenintensive Tätigkeiten nicht mehr fördern. Alles, was direkt mehr Verkehr und Bautätigkeit verursacht wie etwa zusätzliche Beherbergungskapazität und Zweitwohnungen, Massenevents und Straßenbauten, muss bei echtem Klimaschutz unterbleiben. Der motorisierte Individualverkehr muss laut Klimaplan und Mobilitätsplan schrumpfen, und zwar um 30% bis 2037. Damit muss man aber schon heute anfangen und nicht erst in 10 Jahren.
Heißt das auch, dass wir nicht weiterhin Boden verbrauchen dürfen?
Genau, denn damit entstehen Hitzeinseln, gehen CO2-Senken verloren, wird die Absorption von CO2 durch gesunde Böden noch geringer. Im Sinne des Klimaplans müssen wir den heutigen Umfang der Bodenversiegelung Jahr für Jahr herunterfahren und bis 2040 auf netto null ankommen. Das heißt, es darf auch nicht immer mehr Wald in Weideland umgewidmet werden. Was im Sinne des Klimaschutzes nicht weiterwachsen darf, sind Neubauten. Da wird immer sehr viel Beton verbraucht, und die Zementherstellung ist einer der größten Klimakiller. Nicht mehr weiter wachsen soll der gesamte Ressourcenverbrauch, weil wir heute schon zu hohen Materialverbrauch haben und eine zu geringe Recyclingquote.
Was sollte die Politik jetzt tun? Was erwarten Sie von der Landesregierung?
Von der nächsten Landesregierung ist zu erwarten, dass der Klimaplan 2040 umgesetzt wird, planmäßig und konsequent. Dafür muss er mit einem Landesklimaschutzgesetz noch verbindlicher festgeschrieben werden. Dann müssen zahlreiche Gesetze und Verordnungen folgen, um die Maßnahmen in Einzelbereichen zu regeln. Südtirol kann in Italien eine Vorreiterrolle einnehmen, sich am Beispiel vieler Regionen im Ausland orientieren. Für alle Sektoren sollte ein verpflichtender Reduktionspfad mit jährlichen Höchstmengen an Treibhausgasemissionen festgelegt werden. So etwa wird in Österreich beim neuen Bundes-Klimaschutzgesetz vorgegangen: es wird der Endenergieverbrauch pro Jahr und Sektor festgelegt wird, in der Folge werden Reduktionsziele bei den CO2-Emissionen für die Sektoren und Bundesländer festgeschrieben, also auch für jene Bereiche außerhalb des EU-Emissionshandels. Beispiel Heizungswende. In Österreich gibt es noch 1,9 Millionen fossil betriebene Heizungen, die bis 2040 zu ersetzen sind, wenn man klimaneutral werden will. Alle sanierungsbedürftigen Häuser sollen in diesem Zeitraum saniert werden. Dafür müssen die Rahmenbedingungen und die Förderungen geschaffen werden. Die Bundesländer müssen dann die jeweiligen Klimaschutzpläne und Klimaschutzgesetze erstellen. Dies sollte in Italien gleichermaßen erfolgen, aber wir hängen weit zurück.
Welchen Zweck hätte ein solches Klimaschutzgesetz?
Es soll einen Zielpfad für die jährliche Reduktion der CO2-Emissionen vorgeben, um bis 2040 Nullemission zu erreichen. Es soll auch Sektorenziele und Etappenziele vorgeben, z.B. bis 2030 -55%, wie von der EU gefordert. Das bedeutet im Klartext, dass Südtirol von heute rund 2 Millionen Tonnen CO2 auf maximal eine Million Tonnen runterfahren muss, und das bis 2030. Ein solches Gesetz würde klare Verbindlichkeit und langfristige Planbarkeit für die privaten Haushalte und die Unternehmen schaffen. Ein Plan kann dagegen von der Landesregierung von heute auf morgen abgeändert werden. Ein Landesklimaschutzgesetz würde neue Fördermaßnahmen für erneuerbare Energie schaffen, würde neue Instrumente und Kriterien für die Klimaverträglichkeit von Vorhaben einführen. Das Land könnte auch einen Klimacheck einführen, wie das Österreich getan hat. Die Landesregierung will laut Klimaplan bis Jahresende 2024 alle Landesgesetze und Landesförderungen auf ihre Klimarelevanz untersuchen. Das ist zu begrüßen.
Wo sehen Sie die größten Widersprüche?
Sehr krass beim Flugverkehr: SkyAlps will die Passagierzahlen verdreifachen, Flüge verdoppeln, Flugzeuge dazukaufen. Das alles steht im Gegensatz zum Klimaplan. Dort wird der Flugverkehr gar nicht einmal erwähnt. Fliegen ist und bleibt die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Große Widersprüche im Tourismus: immer noch wird die Beherbergungskapazität ausgebaut. Das bedeutet unvermeidlich mehr Ankünfte, mehr Nächtigungen, mehr Anreisen mit dem eigenen Fahrzeug. 93% der Südtirol-Urlauber kommen mit dem eigenen Fahrzeug. Ein Widerspruch auch beim Bauen, denn bis 2040 soll die Neuversiegelung netto auf null gesetzt werden. Widersprüche gibt‘s auch in der Mobilitätspolitik: immer mehr Bürger sollen auf den ÖPNV umsteigen, richtig so. Doch gleichzeitig wird Südtirol so massiv beworben, dass laufend zehntausende neue Besucher ins Land gelockt werden, die mit dem eigenen Auto anreisen. So hebt sich die Einsparung seitens der einheimischen PKW-Nutzer mit der zusätzlichen touristischen Mobilität auf. Auch die Viehhaltung zurückgefahren werden, weil sie den Großteil der 17% der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft ausmacht. Doch dafür ist in Südtirol nichts vorgesehen.
„La botte piena e la moglie ubriaca“: wird das das Leitmotiv in Südtirols Politik sein?
Dieser italienische Lehrsatz geht beim Wein nicht gut, noch weniger beim Klimaschutz. Zum einen soll weniger THG ausgestoßen werden, zum anderen sollen Güterexport, Tourismus und Transit-Güterverkehr auf der Straße doch wachsen. Zum einen soll der motorisierte Individualverkehr sinken, zum anderen will man mehr Ankünfte und Nächtigungen. Zum einen weniger Neuversiegelung, zum anderen mehr Baurechte für Bauern und Hoteliers. Zum einen Ausstieg aus der fossilen Energie, zum anderen Subventionierung von Dieseltreibstoff etwa für Frächter und Landwirte. Das alles klingt wie eine nicht ernstgemeinte Diät: auf der einen Seite spart das Land viele Emissionen ein, auf der anderen öffnet es die Türen für neuen Energieverbrauch, der sich noch lange aus fossiler Energie speist.
Mehr dazu in: Thomas Benedikter, Do geaht nou a bissl. Klimaschutz auf Südtirolerisch. Arcaedizioni
Lavis 2024, 13,00 Euro. Im Buchhandel.
UN-Klimakonferenz
COP-28: ist „abwenden“ genug?
Zwei Wochen hatten tausende Diplomaten im ölgetränkten Dubai über Formulierungen gebrütet, die für alle COP-Vertragsstaaten irgendwie verdaulich sein sollten. Auch wenn die „Abkehr“ von den fossilen Brennstoffen beschlossen worden ist, lässt das Abschlusspapier zu wünschen übrig.Resultat der Sprachakrobatik der Regierungsvertreter ist, wie gewohnt, ein 21-seitiges Abschlussdokument mit Licht und Schatten. Zum ersten Mal ruft eine Klimakonferenz die Welt auf, sich von Kohle, Gas und Erdöl abzuwenden. Dies war zwar schon 1992 in Rio de Janeiro artikuliert worden, dennoch hat der globale CO2-Ausstoß 2022 mit 38,6 Mrd Tonnen sein Rekordhoch erreicht. UN-Klimachef Stiell sagte, noch steuere die Welt auf 3° Erderhitzung zu. Nichts steht im Dokument, dass keine neuen Kohlekraftwerke gebaut werden dürfen; nirgendwo werden alle Länder aufgefordert, 2025 den Höhepunkt der CO2-Emissionen zu erreichen; auch werden die Ölförderländer nicht verpflichtet, auf neue Explorations- und Förderprojekte zu verzichten.
Bis kurz vor Ende hatten sich einige Öl- und Gasförderländer dagegengestemmt, den Ausstieg aus der fossilen Energie festzuschreiben. Auch verständlich, denn damit würde man den Ländern mit der höchsten CO2-pro-Kopf-Emission die Geschäftsgrundlage entziehen. Sie würden sich wohl kaum an solche Erklärungen halten, sondern allenfalls auf einen weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Öl und Gas reagieren, um den Hahn zurückdrehen.
Warum reicht dieses Dokument nicht aus?
In der Abschlusserklärung der COP28 findet sich kein direkter Bezug zu den nationalen Beitragszusagen zur CO2-Emissionreduktion (NDC). Die famosen NDC von 2016 waren vor der UN-Klimakonferenz von Dubai evaluiert worden (stocktaking process) und hatten sich als bei weitem unzureichend entpuppt, um das 1,5° bzw. das 2°-Ziel bei der Erderhitzung einzuhalten. Die im Vorfeld der COP-28 evaluierten Zusagen für die NDC decken 95% der globalen Emissionen in 168 Staaten ab. Um das 2°-Ziel zu erreichen, dürften 2030 nicht mehr als 39 Mrd. t CO2 ausgestoßen werden. Doch auch wenn diese NDC-Zusagen der Regierungen realisiert würden – so Italy for Climate – würde man 2030 auf CO2-Gesamtemissionen zwischen 48 und 55 Mrd. t CO2 gelangen. Damit landet man eher bei 3° als bei 2° Erderhitzung. Das heißt, die Staaten müssten ihre nationalen Beitragzusagen (NDC) so rasch wie möglich neu und strenger formulieren und sich dann unter Anwendung von Sanktionen zur Umsetzung verpflichten. Das ist in Dubai nicht geschehen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Zudem weist die Abschlusserklärung von Dubai einige problematische Schlupflöcher auf wie etwa den Verweis auf Erdgas als Übergangslösung.
Private und staatliche Konzerne pumpen mehr als 1 Billion USD in neue Öl- und Gasförderung
Während 100.000 Menschen nach Dubai fliegen, um über die Klimapolitik zu diskutieren, pumpen private und staatliche Konzerne in vielen Ländern hunderte Milliarden an Neuinvestitionen in die fossilen Energieträger. Dazu gehört auch der Staatskonzern der VAE, den der Konferenzpräsident Al Jaber leitet. Wenige Wochen vor Beginn der COP28 hatte die ADNOC noch ein 16 Mrd. USD schweres Erdgasförderprojekt genehmigt. Würden all die geplanten Vorhaben realisiert, die Förder- und Raffinerieanlagen gebaut, würde dies die Fördermenge um 2% jährlich von 2020 bis 2030 erhöhen. 2030 hätte man eine weit höhere Fördermenge als mit dem 2°-Ziel vereinbar. Eigentlich hätte in der Abschlusserklärung von Dubai ein Investitionsstopp für Neuexplorationen und Erschließungen von Öl- und Gasvorkommen beschlossen werden müssen. Nur bestehende Anlagen könnten dann im phasing-out-Betrieb weiterlaufen. Die OPEC und andere erdölproduzierende Länder müssten mit immer weniger Einnahmen auskommen, die großen Ölkonzerne müssten einem systematischen und raschen Umbau unterworfen werden, die Finanzholdings müsste viel zügiger zum „divestment“ schreiten, zum Abzug der Finanzanlagen von Investitionen in den fossilen Bereich. All das fehlt im COP-Abschlussdokument.
Die Staaten hätten es in der Hand
Bei diesem Umbau der Öl- und Gasindustrie sitzen auch die Staaten selbst am Hebel, wie z.B. der zwölftgrößte Ölkonzern der Welt, die ADNOC der Vereinigten Arabischen Emirate, den der COP-28 Präsident Sultan al-Jaber leitet. Gut die Hälfte der globalen Öl- und Gasförderung erfolgt durch staatliche Ölgesellschaften, die 40% der Investitionen tätigen. Derzeit planen allein die nationalen Ölgesellschaften, bis 2030 400 Milliarden Dollar in Öl- und Gasprojekte zu investieren. Auch die USA unter Präsident Biden haben wieder neue Aufträge für Ölbohrungen in den USA vergeben, dass Deutschland als Kompensation zu den russischen Gaslieferungen mehr Kohle verstromt und Großbritannien neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee genehmigt hat.
Es geht um Projekte, die sich nur rentieren, wenn CO2-Emissionen weit über das 2°-Ziel hinaus freigesetzt werden. Entweder die Einhaltung der globalen Klimaziele oder die Amortisierung dieser Investitionen: beides gleichzeitig geht sich nicht aus. Zahlreiche staatliche Energiekonzerne schaffen das finanziell nur, weil sie von Regierungen massiv subventioniert werden. Damit unterlaufen diese Staaten systematisch die von ihnen mitunterzeichneten Pariser Klimaziele. Kein Wunder, denn es gibt noch keine verbindliche internationale Regulierung, die Investitionen in die Förderung von fossilen Energieträgern einschränkt oder verbietet. Richtigerweise hat die COP28 beschlossen, die Investitionen in die erneuerbare Energie zu verdreifachen. Doch wenn so gewaltiges Kapital in neue Förderung, Raffinerie und Transport von fossiler Energie gesteckt wird, bleiben naturgemäß für erneuerbare Energien viel weniger Mittel übrig. Auch hier zu wenig Konsequenz im Abschlussdokument von Dubai.
Nachfrageseite umso mehr gefordert
Trotz aller Bemühungen des größeren Teils der Signatarstaaten des Pariser Klimaabkommens von 2015 ist es nicht gelungen, in der Abschlusserklärung der 28. Klimakonferenz in Dubai den verpflichtenden Ausstieg aus den fossilen Energieträgern festzuschreiben. Nur „Abkehr“ von der fossilen Energie ist zu wenig: das bemängelte sogar der US-Vertreter John Kerry. Der zu erwartende Widerstand einiger Öl- und Gasförderländer hat diesen unumgänglichen Schritt verhindert. Umso mehr ist jetzt die Nachfrageseite, also die Verbraucher fossiler Energien in aller Welt, aufgerufen, die Exitstrategie aus der fossilen Energie konsequent weiterzutreiben. Alle Staaten und vor allem die Industriestaaten, zum Großteil Öl- und Gasimportländer, können als Nachfrager auf dem Weltmarkt die Fördermenge fossiler Energie wesentlich mitbestimmen, indem sie die Energiewende noch konsequenter verfolgen und ihren Import von Gas und Öl runterfahren. Die EU muss umso mehr an ihrem Zwischenziel von -55% CO2-Emissionen bis 2030 und an der Klimaneutralität bis 2050 festhalten. Die Industrieländer müssten zum einen die Energiewende beschleunigen, zum anderen eine Allianz mit den Schwellenländern bilden, damit nicht der globale Süden mit billigerem Öl und Gas dazu verführt wird, doch wieder auf die fossile Energie zu setzen. Für derartige Beschlüsse und Abschlusserklärungen sind wohl noch einige COPs abzuwarten, bevor größere Freudenfeste zum Durchbruch beim Klimaschutz angesetzt werden.
Thomas Benedikter
17.12.2023
Neue Landesregierung
Klimaschutz und Koalitionsabkommen
Wenn die kommende Mitterechts-Regierung in Sachen Klimaschutz Kontinuität wahren will, muss sie den Klimaplan umsetzen. Auf die nächste Landesregierung warten eine Fülle von Maßnahmen und Entscheidungen, wenn bis 2040 Klimaneutralität erreicht werden soll.An der Wahlurne hatte der Klimaschutz für die Südtiroler Wählerschaft keine große Dringlichkeit. Andere Themen haben sich mächtig ins Bewusstsein des Stimmvolks gedrängt. Auch für die jungen Wähler, die die Folgen der Erderhitzung weit stärker spüren werden, scheint der Klimaschutz nachrangig gewesen zu sein. Denn all jene Parteien, die in ihrem Wahlprogramm die anspruchsvollsten Aussagen zum Klimaschutz führten, haben an Sitzen verloren oder nichts dazugewonnen. Wieviel dagegen der italienischen Rechten am Klimaschutz liegt, lässt sich an der gesamtstaatlichen Politik beobachten. Dabei bremst die Lega in Rom wirksamen Klimaschutz deutlicher aus als die FdI, während in Südtirol ex-LR Vettorato (Lega) mit federführend beim Klimaplan war. Die Lega hat ihn abgesegnet. Konsequenz von SVP und Lega in dieser Hinsicht wird man auch daran messen können, ob die Anwendung des Klimaplans Teil des Koalitionsabkommens wird. Zudem wird der für Juni 2024 zu erwartende nationale Klimaschutzplan die Pflicht zur CO2-Emissionsreduktion allen Regionen und autonomen Provinzen vorschreiben. Wenn bis 2040 Klimaneutralität erreicht werden soll, warten auf die nächste Landesregierung eine Fülle von Maßnahmen und Entscheidungen. Hier drei Beispiele.
- 1. Die Heizungswende: in Südtirol gibt es einen hohen Altbaubestand ohne ausreichende Wärmedämmung, fossil beheizt. Nachdem der Superbonus nicht mehr im bisherigen Umfang weitergeführt werden kann, kommt es in Südtirol wie in ganz Italien darauf an, dass die Wohnungseigentümer selbst mehr investieren, möglichst mit Unterstützung des Landes. Laut Klimaplan soll der Verbrauch von Öl und Gas für Heizzwecke bis 2030 um 60% reduziert werden, bis 2037 um 85%. Doch von einer Förderung des Heizungsaustauschs für alle Arten von Wohnungsbesitzern (auch Gebäude mit weniger als 5 Wohneinheiten) ist im Klimaplan 2040 keine Rede. Genauso wenig von einem „Energiebonus“, wie ihn das Bundesland Tirol an alle Wohnungsbesitzer auszahlt, die ihre fossil betriebene Heizung austauschen. Ein entsprechender Fördertopf muss bald Gestalt annehmen, damit die Heizungswende planbar und finanzierbar wird.
- 2. Südtirols Unternehmen beziehen jährlich mehrere hundert Millionen Euro an Beiträgen vom Land, der Löwenanteil geht dabei an die Landwirtschaft. Die konkreten Subventionszwecke sind breit gestreut, doch finden sich viele Beispiele, wo Landesbeiträge CO2-Emissionen eher fördern als einschränken. Die Verbesserung der betrieblichen CO2-Bilanz wird fast nie zur Auflage gemacht. Wenn z.B. die bauliche Expansion von Landwirtschafts- und Gastgewerbebetrieben gefördert wird, steigen die CO2-Emissionen. Der erste Schritt zum Abbau klimaschädlicher Subventionen wäre volle Transparenz, der zweite die transversale Einführung von Klimaschutzkriterien bei der Beitragsvergabe, der dritte Schritt die gezielte Umschichtung von Landesmitteln zu Wirtschaftstätigkeiten mit geringen CO2-Emissionen. Dem Klimaplan und seinen Zielen widersprechende Subventionspraxis müsste ein Ende haben.
- 3. Laut Klimaplan 2040 soll der Anteil der armutsgefährdeten Bevölkerung schon bis 2030 um 5 Prozentpunkte von fast 18% (2019) auf 13% (2030) gesenkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten 22.000 relativ arme Haushalte durchschnittlich 3.500 Euro im Jahr mehr einnehmen, müssten Sozialleistungen verschiedener Art, vom Wohngeld über die finanzielle Sozialhilfe bis hin zu den Mindestrenten aufgestockt werden. Sehr wirksam wäre ein gesetzlicher Mindestlohn mit eigenem Zuschlag für das Hochpreisland Südtirol, für welchen das Land aber keine Zuständigkeit hat. Gegenfinanzieren könnte das Land höhere Sozialausgaben über die steuerliche Belastung von hohen Einkommen und Vermögen. Auch dafür hat das Land nur sehr begrenzte Zuständigkeiten, kann allenfalls die GIS erhöhen. Soziale Klimagerechtigkeit geht nur mit mehr Umverteilung: die wohlhabenden Haushalte belasten das Klima nachweislich stärker, die Geringverdiener werden unter ständig steigenden Energiekosten mehr zu leiden haben. Ein Ausgleich ist geboten.
Ein sehr wirksamer Hebel zur Dekarbonisierung wäre eine CO2-Steuer, die in Europa von 10 Mitgliedsländern, noch nicht aber von Italien eingehoben wird. Während Österreich 2023 erst einen Satz von 35 Euro pro Tonne CO2 anwendet, liegt der CO2-Preis in der Schweiz schon bei 87 Euro pro Tonne CO2. Würde das Land Südtirol den Schweizer Satz übernehmen, könnte es jährlich 174 Millionen Euro einnehmen, dadurch die CO2-Emissionen senken und gleichzeitig einen „Heizungswendefonds“ speisen, der an Geringverdiener zinslose Kredite für den Heizungsaustausch ausschütten würde. Wiederum fehlt hier die Zuständigkeit, doch kann ein „Landesklimaschutz-Rotationsfonds“ auch aus anderen Quellen gespeist werden, wie z.B. aus einem Teil der PENSPLAN-Anlagen oder eben aus dem Landeshaushalt.
Dringend geboten auch die Einführung einer „Klimaverträglichkeitsprüfung“ für alle größeren Bauvorhaben und Erschließungsprojekte sowohl privater wie öffentlicher Träger. Wenn die neue Landesregierung Ernst macht mit dem Klimaplan, dürfen keine Projekte mehr zugelassen werden, die bei einer umfassenden CO22-Bilanz durchfallen, erhoben von einer unabhängigen Prüfstelle des Landes. Beispiel: 11 Millionen für eine Seilbahn, die quer durch den gerodeten Wald parallel zu einer Straße Touristen nach oben liftet, wie im Fall der Seilbahn Tiers-Frommer Alm geschehen, sind nicht nur hinausgeworfenes Steuergeld, sondern auch 11 Mio. weniger für echten Klimaschutz.
Thomas Benedkiker
9.12.2023
Darf sich Südtirol CO2-Senken anrechnen lassen?
Der Klimaplan 2040 will die Senkenleistung von Torf aufwerten und seinen Abbau verbieten. Außerdem soll der Wald seine Funktion als CO2-Senke verstärken. Darf dies als Kompensation der in Südtirol erzeugten Treibhausgase angerechnet werden?Als Kohlenstoffsenke (auch CO2-Senke) gilt ein natürliches Reservoir, das vorübergehend mehr Kohlenstoff aufnimmt und speichert, als es abgibt. Erst in jüngster Zeit sind Senken klimapolitisch relevant geworden, weil sie das menschengemachte CO2 aus der Atmosphäre absorbieren und die Erderhitzung etwas verlangsamen. Neben der wichtigsten Wenke, den Meeren, werden aber bisher wichtige Kohlenstoffsenken wie Wälder und Moore zunehmend zerstört (z.B. der Amazonas-Regenwald), während gleichzeitig Waldbrände und auftauender Permafrost in der Taiga gespeichertes CO2 in Massen frei geben. In Summe stellt der Sektor Landnutzung aktuell eine Nettosenke von 6,0 Gt CO2 dar, die vor allem auf die CO2-Absorption der Wälder zurückzuführen ist (vgl. Georg Niedrist, Emissionen der Südtiroler Landwirtschaft und Szenarien zur Erreichung der Klimaneutralität, EURAC 2022, 107).
Die in Südtirol vorhandenen CO2-Senken sind ziemlich überschaubar: lebende Biomasse (vor allem Wald), der Humus der Böden und Moore. Letztere bedecken weltweit 3% der Erdoberfläche, binden im Torf ein Drittel des gesamten terrestrischen Kohlenstoffs und rund das Doppelte des in Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs (vgl. Stefan Zerbe, Kein Platz für Torfabbau bei echtem Klimaschutz, in: Klimaland Südtirol? 2022, 74). Ein einziger Hektar Moor speichert schon 1000 Tonnen Kohlenstoff. Die Wiedervernässung von Mooren auf großer Fläche wäre enorm wichtig für den Klimaschutz. Allein in Südtirol sind nur mehr wenige Moore und Feuchtgebiete übriggeblieben, bis vor Kurzem ist im Unterland sogar noch Torf abgebaut worden.
Wie im übrigen Alpenraum wäre in Südtirol als terrestrische Senke für Kohlenstoff Wald noch reichlich vorhanden, die fast die Hälfte der Landesfläche einnimmt. In den borealen Nadelholzwäldern, also unseren Hochwäldern, steckt die Hälfte des CO2 im unterirdischen Pilzgeflecht. Allerdings nimmt die Speicherleistung des Waldes ab, sowohl wegen Übernutzung, also Holzeinschlag, als auch wegen dem Klimawandel selbst, man denke an Stürme wie Vaia, die 6000 ha Wald flachgelegt haben, und den Borkenkäferbefall. Beim typischen alpinen Nadelwald wird die CO2-Speicherung im Vergleich mit den CO2-Emissionen des Alpenraums als gering eingestuft (unter 10%).
Nun nimmt zwar die Waldfläche in Südtirol tendenziell zu, wie aus dem Agrar- und Forstbericht 2022 hervorgeht, aber zwischen Waldschäden und Rodungen ist nicht gesichert, ob auch die Senkenleistung der Wälder zunimmt. Aufforstungen wären angesagt, z.B. von aufgelassenen Almen, am besten von versiegelten Flächen. Allein in Südtirol wird im Zuge von Grün-Grün-Umwidmungen, von Bautätigkeit, der Neuanlage von Speicherbecken und Pistenerweiterungen immer noch viel Wald gerodet. Dies ist umso bedenklicher als auch die großen CO2-Senken des tropischen Regenwaldes laufend dezimiert werden, wozu die Fleischproduktion der Industrieländer (einschließlich Südtirol) wesentlich beiträgt.
Im Klimaplan Südtirol 2040 ist den CO2-Senken ein Aktionsfeld gewidmet (5.13 Klimaplan Südtirol 2040). Dieses erschöpft sich in der Einstellung des Abbaus von Torf. Es finden sich keine Maßnahmen zum Aufbau neuer Senken, zum Bodenschutz, zum rigorosen Schutz des Waldes. Dabei vergehen 100-150 Jahre, bis ein Wald wieder voll aufgebaut ist, etwa in den Vaia-geschädigten Gebieten. Der Wiederaufbau der Speicherkapazität braucht noch länger. Je mehr Holz man in den Wäldern lässt oder zumindest verbaut statt zu verbrennen, desto mehr CO2 bleibt gespeichert. Konsequenter Klimaschutz und großflächige Rodungen passen weder in den Alpen noch im tropischen Regenwald zusammen.
Wie steht es nun mit der sog. „Anrechenbarkeit“ der CO2-Senken? Darf ein Land oder eine Region seine CO2-Emissionen mit einer nachgewiesenen Senkenleistung seines Gebiets kompensieren? Laut Kyoto-Protokoll von 1997 war es möglich, sich CO2-Senken anrechnen zu lassen, sofern sie nachweislich auf menschliche Eingriffe nach 1990 zurückzuführen waren. Außerdem durften Kompensationsleistungen in Drittstaaten in bestimmtem Umfang dazugekauft werden (internationaler Handel mit Emissionszertifikaten) wie z.B. die Aufforstung von Wald im Ausland. Diese Art von Operation ist stark missbrauchsgefährdet.
Angesichts der Schwierigkeit, tatsächlich von Menschen neu geschaffene Senken von natürlichen Senken zu unterscheiden, wurde dann für jedes Land eine maximal anrechenbare Senkenleistung aus der Waldbewirtschaftung festgelegt. Der natürlich gewachsene Wald darf nicht als CO2-Senke angerechnet werden, weil es ihn schon gab und der Anstieg des CO2 in der Atmosphäre trotz dieser bestehenden Senken weitergeht. Auch der sich in Südtirol aufgrund höherer Temperaturen nach oben ausdehnende Wald ist paradoxerweise ein „Verdienst“ des Klimawandels, nicht des Menschen, darf also nicht angerechnet werden. Somit geht es nur um zusätzliche CO2-Senken, also wiedervernässte Moore, neu aufgeforstete Flächen, Bodenverbesserung durch andere Landnutzung von Kulturgrund. In diesem Sinn wäre es für den Klimaschutz wichtiger, auf weitere Rodungen zu verzichten, die Versiegelung tatsächlich zurückzuschrauben und mehr Pflanzen anzubauen, die viel CO2 binden.
CO2-Senken bilden langfristig keinen nachhaltigen Klimaschutz: in alten Wäldern nimmt die Senkenleistung ab; Stürme, Waldbrände und Borkenkäfer setzen viel CO2 frei, dann wird Wald sogar zur CO2-Quelle. Die Option Senken gibt uns lediglich etwas mehr Zeit, bis mit Energiesparmaßnahmen, erneuerbarer Energie und einer Abkehr vom mit fossiler Energie befeuerten Wirtschaftswachstum die CO2-Emissionen substanziell reduziert werden können. Der naturräumlich gegebene Wald ist ein Allgemeingut, kein Ersatz für echte Reduktion der Treibhausgasemissionen.
Thomas Benedikter
30.10.2023
Ein Landesgesetz zum Klimaschutz?
Wenn die neue Landesregierung es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss ein solches Gesetz ganz oben auf ihre Agenda sowie ins Koalitionsprogramm, ganz unabhängig von ihrer Zusammensetzung.Der Klimaschutz wird eine der wichtigsten Aufgaben des neuen Landtags sein. Es geht vor allem um die Umsetzung des Klimaplans mit seinen immerhin 157 Maßnahmen, im Juli 2023 offiziell beschlossen. Der Klimaplan Südtirol 2040 – so noch-LH Kompatscher – ist eine politische Selbstverpflichtung, und war ein starkes Thema in einigen Wahlprogrammen, weshalb die Bürger im Regierungsprogramm 2023-2028 zu Recht seine Umsetzung beanspruchen können.
Andernfalls riskiert der Klimaplan zum zahnlosen Tiger zu werden, riskiert man die Erfahrung des alten Klimaplans von 2011 zu wiederholen. Doch dafür reicht die Zeit nicht mehr. Überdies muss der Klimaplan 2040 nachgeschärft werden, denn zahlreiche Maßnahmen sind noch vage und „soft“ (Konzepte, Arbeitsgruppen, Studien). Vor allem den Unternehmerverbänden ist es gelungen, Vieles im Klimapaket möglichst offen und flexibel zu halten. Weil der Klimaplan naturgemäß keine rechtliche Verbindlichkeit hat und seine Ziele von niemandem eingeklagt werden können, zeichnet sich jetzt ein mühseliges Tauziehen zwischen Politik und Interessenverbänden um jeden wirklich wirksamen Schritt zur CO2-Emissionsreduzierung ab. Ein Landesgesetz kann das ändern.
Klimaschutz verbindlich festschreiben
Der einzige Weg, dieses Planungswerk verbindlicher werden zu lassen und sich von vielen Bremsern auf dem Weg zur Klimaneutralität zu lösen, ist ein Klimaschutzgesetz. Erst wenn Ziele quantitativ beziffert werden, wenn CO2-Reduktionsverpflichtungen genau festgeschrieben werden, Verfahren verbindlich geregelt, Sektoren- und Etappenziele hin bis zur Klimaneutralität 2040 festgelegt werden, gewinnt der Klimaplan an Biss.
Südtirol ist dazu von staatlicher Seite nicht verpflichtet, doch die Landesautonomie erlaubt es dem Land, in seinen Zuständigkeiten den Weg für konsequenten Klimaschutz zu bahnen. Auch das Zusammenwirken für die CO2-Reduktionsmaßnahmen zwischen Regierung in Rom und Regionen ist noch nicht geregelt, denn im Unterschied zur Mehrheit der EU-Länder hat Italien noch kein Klimaschutzgesetz. Somit fehlen noch die klaren staatlichen Vorgaben für die Regionen im Klimaschutz. Dieses nationale Gesetz wird kommen und erste Entwürfe liegen schon im Parlament vor. Südtirol kann derweil mit gutem Beispiel vorausgehen, denn Klimaneutralität schon 2040 wird weder Rom allgemein festschreiben noch den Regionen vorschreiben, sondern EU-Vorgaben übernehmen (Klimaneutralität bis 2050). Südtirol braucht dieses Gesetz nicht abzuwarten, sondern kann seinem Anspruch, „Klimaland“ zu sein entsprechend, Klimaschutz in seinen autonomen Zuständigkeiten selbst weiterbringen.
Welchen Zweck hätte ein solches Gesetz?
Im Unterschied zum Klimaplan, eine Art Maßnahmenprogramm, setzt ein Gesetz einen verbindlichen Rahmen, der die Politik in den kommenden 16 Jahren in die Pflicht nimmt. Ein Landesgesetz schafft die nötige langfristige Verbindlichkeit und Planungssicherheit für die Politik, Unternehmen und Gesellschaft. In Deutschland haben aus diesem Grund schon 9 Bundesländer Klimaschutzgesetze mit quantitativen Klimazielen verabschiedet. Neben verbindlichen Zielen braucht es transparente Verfahren, ein systematisches Monitoring, unabhängige Überwachungsinstanzen, Änderungen bei der Vergabe öffentlicher Subventionen und Vergabepraxis, neue Verfahren zur Klimaverträglichkeitsprüfung von Großprojekten, Regelungen zum Klimaschutz in den Gemeinden und einiges mehr.
Welche Kernelemente sollte das Landesklimaschutz umfassen?
Vor allem muss ein quantifiziertes Minderungsziel (Klimaneutralität) festgelegt werden, das auch mehrere Zwischenziele vorsieht. Der Klimaplan, seine Umsetzung, seine regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung werden zur Aufgabe der Landesregierung. Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien wird damit zum öffentlichen Auftrag und gesetzlichen Pflicht. Neue Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien und zum Abbau der fossilen Energieverwendung müssen durch den Landtag. Dies erlaubt es der Landesregierung Durchführungsverordnungen zu Einzelbereichen des Klimaschutzes zu beschließen.
Das Klimaschutzgesetz setzt auch den Rahmen für eine klimaneutrale Landesverwaltung, für Maßnahmen im öffentlichen Gebäudebereich und bei den privaten Heizungen, bei der Mobilität und im öffentlichen Beschaffungswesen. Um diese Vorbildfunktion auch auf die Gemeinden auszudehnen, könnte das Land Fördermaßnahmen für Klimaschutz-Gemeinden ins Gesetz schreiben. Dort wird sich auch ein Mechanismus für das Monitoring und die Berichtspflichten finden, die alle 2-3 Jahre erfüllt werden müssen. Ein unabhängiges Expertengremium berät die Landesregierung, schlägt selbst Maßnahmen vor und überwacht die Berichtspflichten. Es muss sich um ein vom Landtag berufenes interdisziplinäres Wissenschaftlerkomitee handeln, das keiner Weisungsmacht untersteht.
Wenn die neue Landesregierung es ernst meint mit dem Klimaschutz, muss ein solches Gesetz ganz oben auf die Agenda und ins Koalitionsprogramm, ganz unabhängig von ihrer Zusammensetzung. Denn Klimaneutralität ist bis 2040 gar nicht erreichbar, wenn nicht Ziele und Maßnahmen gesetzlich untermauert werden.
Thomas Benedikter
22.10.2023
Salvini: mehr Einsatz für schlechte Luft
„L’impegno continua“, ruft ein lächelnder Salvini von den Wahlplakaten der Lega herab. In der Tat: „L’impegno per più traffico continua“.In welcher Welt lebt Minister Salvini eigentlich, der gestern am Brenner für freie Fahrt für LKW demonstriert? 2022 haben 2,48 Mio. LKW den Brenner gequert, Tendenz steigend, 29,5% davon sind laut Mobilitätsplan 2035 Umwegverkehr. Der gesamte innere Alpenbogen (Fréjus bis Brenner) wurde 2021 von 5 Millionen schweren Strassengüterfahrzeugen gequert.
Der größere Teil davon benutzte die österreichischen Alpenübergänge. Allein 39,7 Mio. von insgesamt 72,5 Mio Tonnen (54,7%) Tonnen des Straßengüterverkehrs zwischen Frejus und Brenner hat die Brennerroute geschluckt. Bis 2040 soll das Verkehrsvolumen trotz Inbetriebnahme des BBT 2032 gemäß Südtiroler Mobilitätsplan um bloß 10,7% sinken. Damit wird die Brennerautobahn auf Jahrzehnte hinaus Mensch und Umwelt zwischen Kufstein und Verona belasten, wird der Haupttransitkanal der Alpen bleiben.
Auf der Brennerautobahn fährt ein gutes Drittel der 2,48 Millionen LKW (Fahrten im Jahr 2022) nicht den Bestweg, sondern einen Umweg bzw. Mehrweg. Das entspricht für 2019 880.000 LKW – so die alle 5 Jahre erscheinende CAFT-Erhebung, die eine um mehr als 60 km kürzere Alternativroute über einen anderen Alpenpass (vor allem Gotthard und Tauern) gehabt hätten. Nur 40% der Transit-LKW über den Brenner sind laut CAFT auf dem Bestweg unterwegs, während am Gotthard 97% des Schwerverkehrs auf der Straße den kürzesten Weg nimmt. Nebenbei war der Gotthard-Basistunnel (Bahn) im Jahr 2022 nur zu 62% ausgelastet und hätte all diese LKW aufnehmen können. Rund ein Fünftel aller Transit-LKW auf der Brennerroute fahren sogar mindestens 120 km länger, nur um einige Euro zu sparen.
Fast 53 Millionen umsonst gefahrene LKW-Kilometer: das ist ein Hohn auf das Prinzip der Kostenwahrheit. Es straft jene regierenden Politiker Lügen, die den Klimaschutz und „nachhaltige Mobilität“ als Priorität ausgeben. Es führt die EU selbst vor, die eine eigene „Strategie für intelligente und nachhaltige Mobilität“ verabschiedet hat, um die Klimaneutralität bis 2050 zu ermöglichen. Dabei würde es genügen, endlich die EU-Wegekostenrichtlinie ( (Wegekostenrichtlinie) (Eurovignette) anzuwenden. Im Klartext wären das eine deutliche Mauterhöhung. Dann aber auch: keine dritte Fahrspur Verona Nord-Bozen Süd, Nachtfahrverbot, sektorales Fahrverbot, Blockabfertigung, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h bei PKW, Euroklassen-Fahrverbot, mehr Kontrollen, Alpentransitbörse mit streng gedeckelter Jahreskontingent an LKW-Fahrten.
Eine sehr spürbare Mauterhöhung (auch für PKW) wird in Tirol angewandt, in Südtirol und im Trentino von den Landesregierungen viel zu wenig angemahnt. Dafür bräuchte es die Zustimmung von Deutschland und Italien, die derzeit weder Wissing noch Salvini geben würden. Solange die italienische Regierung willfährig Frächter- und Industrieinteressen zu Lasten von Gesundheit und Kima bedient, bleibt Klimaschutz eben reines Lippenbekenntnis; bleiben die Beteuerungen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene Nebelkerzen zur Beschwichtigung des Wahlvolks. Wenn die betroffenen Anrainer längs der A22 schon nicht aufbegehren, hätten sie in zwei Wochen zumindest an der Wahlurne eine Chance, ihre Unzufriedenheit zu zeigen.
Salvini polterte von wegen EU-rechtswidrigen Verkehrsbeschränkungen. Doch Umweg- statt Bestwegverkehr steht grundsätzlich in Widerspruch zu den Klimazielen und zur Mobilitätsstrategie der EU. Die EU hat im Klimagesetz vom 21.6.2021 die Reduktion der CO2-Emissionen um -55% bis 2030 festgelegt, Italien hat sich mit seinem Klimaplan PNIEC verpflichtet, bis 2030 die CO2-Emissionen um -40% zu reduzieren. Der Verkehr ist in Italien der einzige Bereich, in welchem die CO2-Emissionen seit 1990 nicht abgenommen, sondern bis 2022 um 10% zugenommen haben. 90% dieser Emissionen stammen aus dem Straßenverkehr. Wenn die Brennerroute nicht verteuert und reglementiert wird mit Priorität für die Auslastung der schon bestehenden Bahnkapazitäten, wird weder der Umwegverkehr noch der Gesamtverkehr auf der A22 sinken, weder die NO2-Belastung der Anrainer noch die CO2-Belastung des Klimas. Freie Fahrt für fossil betriebene LKW geht genau in die Gegenrichtung von Klimaschutz.
Nun ist es fast schon müßig, einen Minister, der extrem klimaschädliche Großprojekte in die Landschaft setzen will (Zement- und Stahlkoloss über die Meerenge von Messina) auf die klimaschädlichen Auswirkungen des Transit-Umwegverkehrs hinzuweisen. Doch überrascht die zögerliche Haltung von LH Kompatscher, der im Klimaplan die Reduzierung des LKW-Verkehrs festschreiben ließ. Immerhin macht der Verkehr auf der A22 allein schon 37% der gesamten CO2-Emissionen aus dem Verkehr in Südtirol aus. Dort, wo ein voller Schulterschluss mit dem Tiroler Landtag gefragt wäre, der einstimmig die Maßnahmen zur Beschränkung des LKW-Transitverkehrs unterstützt, schlägt er eine „Vermittlung“ zwischen Salvini und den Tirolern vor. Ganz so als wären die Tiroler zu weit gegangen, als wären die Anrainer im Wipp- und Eisacktal, in Bozen und im Unterland nur Zuschauer, nicht Opfer.
Thomas Benedikter
10.10.2023
Was wollen die Parteien beim Klimaschutz?
Die Wahlprogramme und Wahlaussagen im VergleichDer Klimawandel ist bei der DOLOMITEN-Podiumsdiskussion vom 26.9.2023 in Brixen vom Publikum zum Top-Thema erkoren worden (29% der Teilnehmenden), noch vor den niedrigen Löhnen (16%) und der Gesundheitspolitik (17%). Alle Parteien hätten sich den Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben – so die DOLOMITEN in ihrem Bericht vom 4.10.2023 – doch die politischen Vorschläge dazu fallen sehr unterschiedlich aus. Zwischen jenen, die die SVP mit dem Klimaplan 2040 auf dem richtigen Weg sehen (Amhof, SVP), jenen die „die grüne Verbotspolitik“ ablehnen (Stauder, Freiheitliche), jenen, die den Chinesen die Schuld für den Klimawandel zuschreiben, während Südtirol ohnehin für Klimaschutz zu klein sei (Bova, FdI) und jenen, die der Politik vorwerfen, zu lange geschlafen zu haben (Mussner GRÜNEN) und Mahlknecht (Team K) liegen Welten.
Klimaschutz in der Wahlumfrage des SJR
Deutlicher werden die Positionen in der Wahlhilfe für Jugendliche des Südtiroler Jugendrings. Plakativ sprechen sich hier fast alle befragten Spitzenexponenten in den Express-Statements für aktiven Klimaschutz aus, aber eben nur in aller Kürze. Sollen sich Jugendliche tatsächlich daraus ein Bild machen können?
LH Kompatscher verweist auf den Klimaplan mit den 157 Maßnahmen. Die Grundausrichtung sei: wir müssen viel tun und schnell tun, und dabei aufpassen, dass dies sozialverträglich bleibt. Klimaschutz nicht nur für jene, die sich einen Tesla leisten könnten. Das Tourismusangebot soll nicht gedeckelt, sondern anders gestaltet werden. Zur Gratisnutzung des ÖPNV sagt Kompatscher als einer der wenigen nein, weil dann die Leistungen des ÖPNV nicht mehr ausgebaut werden könnten.
Bessone von der LEGA bleibt sehr oberflächlich: für den Klimaschutz sei halt Energie zu sparen. Auch die Jugendlichen seien da nicht so sparsam, wie nötig. Alle müssten mit ihrem konkreten Verhalten einen Beitrag leisten.
Thomas Widmann will für den Klimaschutz alle fossilen Brennstoffe mit erneuerbarer Energie ersetzen. Es gebe unendlich viel Wasserkraft in Südtirol, man müsse in innovative Technologie investieren. Die Verkehrsgewohnheiten sollten sich vollkommen ändern. So spricht sich Widmann für den kostenlosen ÖPNV für alle aus. Er werde sich für den Ausbau der Wasserstofftechnologie einsetzen.
Renate Holzeisen (Liste VITA) meint: „Wir stehen für den Umweltschutz, aber nicht für Klimahysterie. Was als vom Menschen verursachter Klimawandel betrachtet wird, ist absolut zu hinterfragen.“ Die Klimawandelthesen würden weltweit von renommierten Wissenschaftlern beanstandet. Holzeisen profiliert sich damit als eine der wenigen Klimawandelleugnerinnen unter den Kandidatinnen.
Auch Wirth-Anderlan (JWA) ist gegen die „Klimahysterie“, schließlich hätten wir in der Geschichte ja auch schon Eiszeiten gehabt. Südtirol sei dafür schon gut aufgestellt. Beim Tourismus ist der stramme ex-Schützenchef gegen jede Erhöhung, für die Gratisnutzung des ÖPNV, für einen Bettenstopp. Das Wichtigste zum Schluss: „Sich nicht von links-grünen Lehrpersonen erziehen lassen.“
Laut Sven Knoll (Südtiroler Freiheit) soll zwecks Klimaschutz der Verkehr reduziert werden und das Projekt Reschenbahn weiter betrieben werden. Man sollte viel mehr in die Schiene investieren. Das Tourismusangebot sollte nicht erweitert, sondern nur mehr „verbessert“ werden.
Für Repetto (PD) sollten die Menschen zuallererst verstehen, dass der Klimawandel schon im Gange sei. Man müsse auf globaler Ebene dagegen vorgehen und die CO2-Emissionen reduzieren. Dafür müsse man vor allem auf kultureller Ebene mehr tun. Na immerhin.
Fratelli d’Italia sprechen sich frohgemut für den Ausbau des Tourismus aus. Auch der ÖPNV solle für alle gratis sein. Beim Klimaschutz brauche es einen Kulturwandel, alle sollten etwas mehr auf die „cultura ambientale“ achten, und vor allem die Fallen des „green washing“ vermeiden. Was er wohl damit meint?
Jacopo Cosenza (M5S) spricht sich gegen mehr Tourismus und für einen kostenlosen ÖPNV aus. Der Klimawandel werfe soziale und ökologische Probleme auf. In Südtirol sei auch an die Folgen des Klimawandels für die Berggebiete zu denken. Die CO2-Emissionen seien nicht nachhaltig, der Verkehr müsse dringend reduziert werden.
Unterholzner (ENZIAN) hat zum Klimawandel eine klare Meinung: Wir in Südtirol könnten nicht das Weltklima verändern. Wir sollten Südtirol, so wie es heute ist, zu erhalten versuchen. Jeder solle seinen Beitrag leisten, aber nicht – wie jetzt von der EU beschlossen – indem die Verbrennermotoren ab 2035 verboten werden. Hier werde etwas kaputt gemacht, was unsere Generation in den letzten 50-60 Jahren mühsam aufgebaut habe. Da sollte man vorsichtig sein.“ Wer hätte vom ehemaligen Autozulieferer-Betriebschef Unterholzner was anderes erwartet?
Brigitte Foppa von den GRÜNEN begrüßt es, dass der Klimaschutz endlich auf die politische Agenda gekommen sei. Klima- und Umweltschutz sei für die GRÜNEN längst schon Thema und Priorität, als sich noch niemand dafür interessiert habe. Beim Heizen müsse man für den Umstieg auf erneuerbare Energie und für Wärmedämmung sorgen, doch alle Haushalte sollten dabei gefördert werden. Junge Menschen sollten sich bewusster ernähren.
Luca di Biasio (Die Linke) fordert, dass endlich alle den Klimawandel endlich ernst nehmen, denn es gebe immer noch Menschen, die ihn leugnen. Dann sollte auf der Ebene der Industrieproduktion, des Verkehrs, der Gebäudeheizung und bei der Ernährung eingegriffen werden.
Giada Del Marco vom Team K spricht sich dafür aus, die schadstofffreien Energiequellen zu fördern in allen Bereichen.
Sabine Zoderer von den Freiheitlichen meint, dass man gegen den Klimawandel aktiver werden müsse, aber nicht mit Verboten. Verbote bestrafen die Menschen. Auch die Benziner-PKW sollten noch ihren Platz haben. Das Tourismusangebot erweitern? Auf keinen Fall, sagt Zoderer, es gäbe jetzt schon overtourism mit allen Folgen für die Wohnungspreise und Lebenshaltungskosten. Doch auf der anderen Seite dürften die Zweitwohnungsbesitzer nicht bestraft werden.
Der Klimaschutz in den Wahlprogrammen
Ja, es gibt sie noch und sie haben auch Aussagekraft: Wahlprogramme. Die wenigsten Wähler:innen scheinen diese Programme zu konsultieren, entsprechend dünn fallen sie bei manchen Listen aus oder fehlen komplett (Südtiroler Freiheit, VITA, mehrere italienische Parteien wie die Lega). Im Unterschied zur demokratieerfahrenen Schweiz müssen die wahlwerbenden Parteien gar kein Minimal-Programm vorlegen. Der Landtag bringt dementsprechend auch keine Auflistung der Programmpunkte auf seiner Webseite ganz zu schweigen von einer postalischen Zustellung einer Wahlbroschüre an alle Wahlberechtigten. Mit Transparenz will man es in Südtirol auch nicht übertreiben!
Der Klimaschutz im SVP-Programm
Das Wahlprogramm der SVP bringt im Teil II (Unsere Maßnahmen von A bis Z) einige Kernaussagen zur Energiepolitik: „Der schrittweise Umbau unseres auf fossilen Energieträgern aufbauenden, Wirtschaftssystems in Richtung Dekarbonisierung stellt eine Herausforderung dar. Dabei spielt insbesondere die Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energieträger (Photovoltaik und Windenergie) sowie eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft in einer bewirtschafteten Kulturlandschaft eine zentrale Rolle. Durch die erweiterten Möglichkeiten, Photovoltaikpaneele und Sonnenkollektoren auf Gebäuden anzubringen, wird nicht nur die alternative Energieerzeugung vorangetrieben, sondern werden auch bereits versiegelte Flächen werden bestmöglich genutzt.“
Bei Natur- und Landschaftsschutz beruhigt die SVP die Gemüter: „Südtirol bleibt grün. Wir haben im Klimaplan eine nachhaltige und umweltverträgliche Strategie festgeschrieben, die auch künftig ein „grünes Südtirol“ gewährleistet.“
Als oberste Priorität sind darin Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Reduktion des CO2-Ausstoßes, zur Förderung der erneuerbaren Energien sowie insgesamt zu einer „grünen Energieproduktion“ vorgesehen. Unser Konzept für ein effektives Biodiversitätsmonitoring kann man als Vorreitermodell im mitteleuropäischen Raum bezeichnen. Wir sehen Schutzmaßnahmen für die Umwelt in einem breiten Kontext. So wollen wir beispielsweise verstärkt auf E-Mobilität bzw. „green mobility“ setzen, in der Abfallwirtschaft auf eine Kreislaufwirtschaft hinarbeiten oder die NO2-
Konzentration in der Luft senken. Unser politisches Ziel ist es, zukünftig weitere autonomierechtliche Zuständigkeiten im Umweltbereich zu erhalten.
Im Kapitel Wirtschaft findet man auch das: „Wir setzen beim Wirtschaftswachstum auf Qualität und nicht auf Quantität – deshalb werden Unternehmen gefördert, die schonend mit Ressourcen umgehen und im Einklang mit historisch gewachsenen Kontexten wirtschaften. Der Mehrwert definiert sich dabei nicht nur durch unmittelbare Wertschöpfung, sondern orientiert sich unter anderem auch am Gemeinwohlprinzip. Öffentliche Unterstützungen tragen zu mehr Familienfreundlichkeit bei und verfestigen die lokalen Kreisläufe.“
Interessant wird es beim Stichwort „Tourismus“. Die SVP will hier neue Märkte eröffnen und die Bewerbung Südtirols verbessern. Beim Mengenwachstum (sprich Ankünfte und Nächtigungen) will man „mit Bedacht vorgehen“. Das Landestourismusentwicklungskonzept 30+ soll systematisch umgesetzt werden. Was die Lobbys erfolgreich aus dem Programm bugsiert haben, ist der Bettenstopp, der mit keinem Wort erwähnt wird.
Auch beim Verkehr will die SVP das eine und das andere: den ÖPNV stärken und ins kapillare Straßennetz investieren. Beim Schwerverkehr gedenkt die SVP, den Personenverkehr und Warenverkehr auf die Schiene zu verlagern, den Brennerkorridor zu digitalisieren und den Ausweichverkehr auf der Staatsstraße zu unterbinden. Kein Wort allerdings zur Senkung des Umwegverkehrs auf der A22; kein Wort zur Unterstützung der Maßnahmen gegen den übermäßigen Schwerlastverkehr auf der Autobahn des Bundeslands Tirol.
Wo die Kompetenz auch aus dem Programm spricht: Die Grünen
Das Wahlprogramm der Grünen ist da erwartungsgemäß ausführlicher. Im Kap. 2.3 gehen die GRÜNEN darauf ein, „wie wir die Energiewende schaffen - Die fossile Vergangenheit durch eine erneuerbare Zukunft eintauschen“. Die GRÜNEN sehen „die Eindämmung der Klimakrise als größte Herausforderung unserer Zeit.“ Hier der Text: „Der Umbau unseres Energiesystems hin zu den Erneuerbaren Energien ist keine leichte Aufgabe, andererseits birgt er für Südtirol auch riesige Chancen. Wir haben die Möglichkeit, in der Energieproduktion unabhängig zu werden. Südtirol hat die idealen Voraussetzungen dafür. Vereinbarkeit von Energiewende, Landschafts- und Umweltschutz, Bekämpfung von Energiearmut, Partizipation, Akzeptanz und Gerechtigkeit und vor allem die soziale Abfederung sollen das Zentrum unserer Bürger-Energiewende bilden. Dafür braucht es verbindliche Zielsetzungen, eine sichere und angemessene Finanzierung, ein effizientes Management und das Mitwirken aller Bürger:innen und Institutionen.“
Die GRÜNEN sind für:
1) Energieeinsparung und effiziente Nutzung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
2) Erneuerbare Energien und die damit verbundenen Infrastrukturen in der notwendigen Menge ausbauen.
3) Genehmigungsverfahren stark beschleunigen: Beim Ausbau von erneuerbaren Energien den Faktor Zeit mitberücksichtigen.
Die GRÜNEN schlagen vor:
- „Ein Klimagesetz, um beim Klimaplan 2040 Verbindlichkeit und Planungssicherheit herzustellen.
- Einen Klima- und Transformationsfond mit Beiträgen und günstigen Krediten, um eine stabile Finanzierung für leistbare Klimaschutzmaßnahmen zu gewährleisten.
- Einen Klimacheck bei Gesetzen, um Klimaschutz auch bei Maßnahmen in anderen Bereichen und bei Förderungen zu berücksichtigen.
- Ein Klimasekretariat, um die Energiewende gut zu organisieren und fristgerecht umzusetzen (mehr Personal in der öffentlichen Verwaltung).
- Die Einrichtung einer öffentlichen Energy Service Company (Esco), um Haushalte und Unternehmen bei der Steigerung der Energieeffizienz, der Installation von Photovoltaikanlagen oder der Schaffung von Energiegemeinschaften zu unterstützen.“
Die Klimawende müsse aber leistbar für alle sein, unterstreichen die GRÜNEN (Punkt 2.4), denn nur „eine leistbare Klimawende ist eine gelingende Klimawende.“ Die Erderwärmung ist Tatsache und bereits jetzt nicht mehr aufzuhalten. Um die Folgen in einem möglichst erträglichen Maß zu halten, brauche es eine radikale Wende und drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Treibhausgase auf allen Ebenen. Die Umstellung auf klimafreundliche Fortbewegungsmittel, weniger belastende Lebensmittelproduktion und Wohnformen bringe Kosten mit sich. Diese dürfen nicht auf die einzelne Familie, den einzelnen Haushalt abgewälzt werden, sondern müssten in die öffentlichen Haushalte eingerechnet werden. Die Klimawende müsse für alle leistbar sein. Ansonsten wird es erstens Widerstand geben, und zweitens bleibt sie auf eine Elite begrenzt. Nur eine leistbare Klimawende sei eine gelingende Klimawende.
Starke Bedeutung für den Klimaschutz haben auch die Vorschläge in den Bereichen Natur-, Landschafts- und Artenschutz (Punkt 1.1), Grüne Landwirtschaft (Punkt 1.2) und Ernährung (1.5). Keine andere Partei bringt eine solch ausführliche Liste konkreter Vorschläge zum Klimaschutz, keine andere Liste bringt einen derart artikuliertes und zielführendes Maßnahmenprogramm für die Landespolitik wie die GRÜNEN. Wer hätte es auch anders erwartet?
Das Gegenteil davon bietet die Liste VITA, die auf ein Wahlprogramm im engen Sinn komplett verzichtet (zumindest nichts im Internet zu finden) und bei den Statements der Listenführerin (Holzeisen), die den Klimawandel als solchen in Frage stellt. VITA ist damit die einzige Kraft, die sich als Klimawandelleugnerin zu profilieren versucht.
Was schreibt das Team K in sein Wahlprogramm zum Thema Klimaschutz?
Das Team K setzt in seinem Wahlprogramm die Priorität auf den Ausbau der Schiene und des ÖPNV. Das Land müsse sich beim Ausbau von Straßen, bei Umfahrungen und Kreisverkehren, auf landschafts- ressourcen- und umweltschonende Varianten beschränken und die Bevölkerung einbeziehen. Weitere Punkte liegen dem Team K am Herzen:
- “Null Km” Prinzip bei öffentlichen Ausschreibungen forcieren;
- Kreislaufwirtschaft unterstützen/forcieren;
- Finanzielle Anreize zur Verwendung der Öffentlichen Verkehrsmittel durch günstige Jahrespauschalen;
- Ein konkreter Klimaplan anstelle des vagen Plans der Landesregierung, samt Sozialplan und Businessplan;
- Die öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel vorausgehen und Bestandsbauten sanieren und dies möglichst klimaneutral machen;
- Anreizbasierte Klima- und Umweltpolitik, die die Südtirolerinnen und Südtiroler zu einer umwelt- und klimaschonenden Lebensweise animiert.
ENZIAN: Die Klimapolitik ist eine „Planwirtschaft“
Das meint die Gruppe ENZIAN, die es gerne neoliberal hat. Unter „Wirtschaft und Soziales“ bringt es die Unterholzner-Partei so auf den Punkt: „Wirtschaft und Soziales, als Teilbereiche der gesamten Gesellschaft, sowie Umwelt, dürfen nicht in Konkurrenz zueinanderstehen. Eine gesunde Wirtschaft ist Voraussetzung, Sozialleistungen anbieten zu können; eine Gesellschaft, der es gut geht, ist Voraussetzung für eine gesunde Wirtschaft und einer Gesellschaft in demographischem Gleichgewicht. Politik, welche sich auf die eine Seite schlägt, bringt das System aus dem Gleichgewicht und führt zum Wohlfahrtsverlust der gesamten Gesellschaft. Die aktuelle vorangetriebene Klimapolitik wird, wie alle Planwirtschaften der Vergangenheit, ein Irrweg sein, meint ENZIAN. Diese planwirtschaftliche Klimapolitik sei unzweckmäßig, da sie das vorgegebene Ziel („Klimarettung“) nicht erreichen werde, allerdings die heimische Wirtschaft und Gesellschaft mit zusätzlichen Auflagen und Kosten treffen werde, was zu einer weiteren Inflation sowie der Verarmung des Mittelstandes führen wird; „Diese Klimapolitik ist keine echte Umweltschutzpolitik und wird deshalb von uns, Enzian, in keine Art und Weise unterstützt, zudem verfehlt sie das vorgegebene Ziel des Klimaschutzes, bzw. der CO2 Reduktion und führt und führt zu einer Verarmung der Bevölkerung.“
Freiheitliche: Klimaschutz durch billigeren Strom für alle
Beim Wahlprogramm der Freiheitlichen steht in Sachen Umwelt ganz oben: „Günstiger Strom für alle“. Die ganze Bevölkerung soll von Südtirols Energiereichtum profitieren und erneuerbare Energie zu tieferen Preisen als bisher erhalten. Das soll die „Strom-Autonomie“ bewerkstelligen. Das Land soll die auf dem Autonomiestatut beruhende Pflicht, Gratisstrom an die Haushalte weiterzugeben, einlösen und überhaupt beim Strom eine eigene Tarifzone einrichten. Offen bleibt die Frage, inwiefern billiger Strom für alle dem aktiven Klimaschutz und dem Energiesparen weiterhilft.
Die Freiheitlichen wollen nicht nur die Fotovoltaik und Wasserkraft für die Stromerzeugung stärker nutzen, sondern auch das Windkraftpotenzial durch „Klein-Windturbinen“ ausschöpfen. Für die Installation von PV-Anlagen auf dem eigenen Dach soll es mehr Landesförderung geben.
Ansonsten sei der Klimaplan 2040 grundlegend zu überarbeiten, meinen die Freiheitlichen. Hier sei eine Vielzahl an übereifrigen und undurchdachten Maßnahmen versammelt. Dazu gehören laut Freiheitlichen auch das Verbot von Ölheizungen in Neubauten, die einen Eingriff ins Eigentum und eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Bürger mit sich brächten. Also mehr „Freiheit beim Heizen“ und „Zurück zu den fossilen Brennstoffen“. Das ist es wohl, was die Freiheitlichen meinen, wenn es da lautet: „Vernunftbasierter statt ideologisierter Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.“
Für eine Überraschung gut ist die Südtiroler Freiheit, die auf ihrer Website kein Wahlprogramm bringt. Vielleicht sorgt aus ihrer Sicht die Landeseinheit alleine schon für besseres Klima!
Thomas Benedikter
5.10.2023
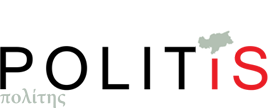
![[[Slogan]]](img/logo_slogan.png)

