Italien allgemein
Referendum
Das Parlament kann nur besser werdenDas für Italien vierte bestätigende Referendum zu einer Verfassungsänderung – nach 2001, 2006 und 2016 – befasst sich mit einem recht punktuellen Eingriff im Vergleich zum umfassenden Anspruch der Reform der Regierung Renzi von 2016. Die Verkleinerung des Parlaments hatte damals auch Renzi im Programm, doch gemischt mit lauter ungenießbaren Hauptzutaten einer zentralistischen und demokratiefeindlichen Gegenreform. Seit 1983 hat es im Parlament 7 Versuche gegeben, die Zahl der Parlamentarier zu senken. Diesmal könnte es klappen, trotz der improvisierten Gegner, denn im Parlament selbst waren 733 Leute für diese Kürzung und nur 64 dagegen.
Geht diese Reform durch, werden 345 schwer bezahlte Parlamentarierposten gestrichen und der Staat erspart sich brutto 82 Mio. Euro im Jahr. Gemessen an den Gesamtkosten der „classe politica“ Italiens nicht gerade viel, nur 5,5% der Gesamtkosten des Parlaments. Immerhin hat Italien doppelt so viele Parlamentarier pro 100.000 Einwohner als Deutschland. Derzeit liegt es in der EU an 22. Stelle in der „Parlamentarierdichte“, weil die vielen kleineren Staaten in der Regel ein proportional zur Wählerzahl größeres Parlament haben.
Verengt man die Wirkung dieser Verschlankung des Parlaments auf die finanzielle Einsparung, wäre die Reform zu bescheiden. Ein kleineres Parlament kann aber durchaus leistungsfähiger sein. Das Problem des heutigen Parlaments ist nicht die fehlende Produktivität in Form der Zahl verabschiedeter Gesetze, denn es produziert eher zu viele und mit zu geringer Qualität und Verständlichkeit. Was in anderen EU-Ländern kleinere Parlamente mit effizienter Arbeitsweise besser schaffen, könnte auch in Italien drin sein. Andererseits läuft die Gesetzgebung immer mehr am Parlament vorbei, das nur die Dringlichkeitsdekrete der Regierung durchzuwinken hat, die viel zu oft mit der Vertrauensfrage verknüpft wird. Wenn das Parlament ihrer legislativen Kernaufgabe schleichend beraubt wird, spielt die Zahl der Parlamentarier eine Nebenrolle. Heute werden für dieses Durchwinken aber 945 Parlamentarier entlohnt.
Freilich hätte dem politischen System Italiens eine andere Reform gut getan, nämlich die Stärkung der Regionen durch mehr Befugnisse und Ressourcen. Dann wäre es auch gerechtfertigt, die schon lange angedachte „Kammer der Regionen“ als eine Art Bundesrat ins Leben zu rufen. Sie könnte den Senat und damit das perfekte Zweikammersystem ablösen. Damit würde Italien einen noch wichtigeren Schritt zur Europäisierung seines Parlaments tun, denn alle größeren EU-Staaten haben eine solche Länderkammer.
Aus demokratischer Perspektive werden Bedenken geäußert, das ein verkleinertes Parlament die Wählerschaft Italiens nicht mehr so genau abbilden könnte wie eben 945 Parlamentarier und die Qualität der Vertretung leide. Einige kleinere Parteien befürchten nicht zu Unrecht, dass bei einem Parlament mit 600 Mitgliedern für sie kein Platz mehr bleibt. Doch zum einen hängt dies ganz vom Wahlrecht ab, das jetzt auch zur Disposition steht. Zum anderen ist die demokratische Qualität der Vertretung nicht proportional zur Zahl der Parlamentarier, ansonsten müssten Tausende im Parlament sitzen. Sie hängt vielmehr davon ab, ob die gewählten Parteien tatsächlich umsetzen, was sie propagiert haben, und ob die gewählten Vertreter dafür einstehen, was sie bei der Wahl versprochen haben, und wie seriös und gemeinwohlorientiert die Vertreter an der Lösung der politischen Probleme arbeiten.
Die direkte Demokratie und zwar eine Volksinitiative wäre das geeignete Instrument, ein neues bürger- und wählerfreundlicheres Wahlrecht einzuführen. Doch dieses Bürgerrecht gibt es in Italien immer noch nicht. Ein Wahlrecht, das die Übermacht der Parteien bricht und den Bürgern das Grundrecht zurückgibt, die politischen Vertreter mit Vorzugsstimme selbst auszuwählen. Diese werden nach geltenden Wahlrecht zum größten Teil von den Parteizentralen vorgeben, während die Vorzugstimmen so gut wie abgeschafft sind. Obwohl die Einführung der echten Volksinitiative mit Volksabstimmung (proposta di legge di iniziativa popolare con diritto al referendum) Teil des Koalitionsvertrags von Lega und M5S war, ist sie nicht eingeführt worden. Damit hätten nämlich die Bürger selbst das Recht, ein demokratischeres Wahlrecht vorzuschlagen und auch die Verfassung so abzuändern, dass statt dem perfekten Zweikammer-System eine Regionenkammer den Senat ersetzt. Keine Partei, die jetzt lautstark fürs NEIN eintritt, um die Qualität der Vertretung zu wahren, hat sich je für die Stärkung der direkten Demokratie stark gemacht. Also geht es doch wieder nur um gut entlohnte Posten.
Fazit: das italienische Parlament kann nur besser werden: mit einem bürgerfreundlicherem Wahlrecht, mit mehr Rechten gegenüber der Regierung, mit einer echten Regionenkammer, und eben auch mit weniger Parlamentariern. Aufschlussreich und gut gemacht, das von Leonello Zaquini gestaltete „Abstimmungsheft“, eine Hilfe für den Bürger, die der italienische Staat bis heute nicht herzustellen imstande war.
SALTO, 15.9.2020
Neuwahlen in Aosta
Neuwahlen in AostaIn Aosta wird am 19. April ein neuer Regionalrat gewählt. Nicht etwa, weil die Legislaturperiode abläuft. Sondern weil die im Mai 2018 gewählte Regionalregierung wegen Unterwanderung durch die 'Ndrangheta abgesetzt worden war. Überraschen konnte das kaum. Seit Jahrzehnten gilt die autonome Region als Hochburg der kalabresischen Mafia.
Bereits vor zwei Jahren hatte die damalige Präsidentin der Antimafia-Kommission Rosy Bindi die Existenz einer seit drei Jahrzehnten anhaltenden "pax valdostaine" angeprangert – "un'alleanza fondata sulla compiacenza di operatori economici, classe dirigente e mafia." In einem Bericht der Ermittler wird die enge Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Mafia geschildert: "Lo stato dell` infiltrazione 'ndranghetista nel tessuto politico, amministrativo e istituzionale è sempre più inquietante".
Der Bürgermeister von Aosta Fulvio Centoz ist offenbar der einzige Vertreter der Lokalpolitik, der in die Affäre nicht verwickelt ist. Für Franco Mirabelli, PD-Sprecher in der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission, ist die Affäre ein gefährliches Warnsignal: "Se fossero dimostrate le ipotesi investigative, saremmo di fronte ad un salto di qualità senza precedenti nella capicità delle mafie di condizionare il governo regionale e le istituzioni." Der Präsident der Region Antonio Fosson ist nach dem Erhalt eines Ermittlungsbescheids ebenso zurückgetreten wie seine Assessoren Laurent Vieren, Stefano Borrello und Luca Bianchi. Die Skandale in der Region reichen weit zurück in die Jahre des mittlerweile geschlossenen Spielcasinos, das einen enormen Schuldenberg angehäuft hatte.
Erst vor wenigen Tagen hatten die Staatsanwälte im Prozess über die letzte Mafia-Affäre in Aosta hohe Haftstrafen gefordert: 20 Jahre für den 'Ndrangheta-Drahtzieher Bruno Nirta, 9 Jahre für den Turiner Anwalt Carlo Maria Romeo, 4 Jahre für den Handwerker Fabrizio De Donato. Lakonischer Kommentar des unbeteiligten Bürgermeister von Aosta, Fulvio Centoz: "Spero che tanti miei colleghi capiscano che è possibile denunciare – senza voltarsi come hanno fatto in troppi."
SALTO im Februar 2020
CIE in Roverè della Luna
Ohne Rückführungen kann Asylrecht nicht funktionierenDas Unterland als „Abschiebezentrum“ titelt gestern SALTO zum geplanten CIE in Aichholz. Doch ohne die Umsetzung von Abschiebungen, kann kein Asylrecht funktionieren
Ein Blick auf die Zahlen ist unverzichtbar, um zu begründen, dass Italien das bestehende Asylrecht besser umsetzen muss, wenn es die Migration und Integration in Griff bekommen will. 2016 war für Italien ein Rekordjahr bei der Flüchtlingsankünften: 181.436 gegenüber 153.842 im Jahr zuvor. Fast 5000 sollen laut UNHCR die Überfahrt von Afrika nach Italien nicht überlebt haben. Auch im Winter werden hunderte Migranten aus Seenot gerettet oder auch nicht, wie in den letzten Tagen.
Bei den Asylanträgen ist Italien in Europa hinter Deutschland auf den zweiten Platz gerückt: über 100.000 haben 2016 Asyl beantragt, mittlerweile werden 175.000 Asylwerber betreut, nur 1.380 davon in Südtirol. Waren früher viele gleich nach Norden weitergereist, haben jetzt diese Nachbarländer die Grenzen dicht gemacht. So stauen sich in Italien sowohl Migranten, die in andere Länder wollen, als auch die Asylanträge mit einem notorisch langwierigen Verfahren und schließlich die Abschiebungen.
Nun hat die EU Italien schon 2015 zugesagt, binnen zwei Jahren 40.000 in Italien gestrandete Asylsuchende aufzunehmen und auf die übrigen Mitgliedsländer zu verteilen, von insgesamt 160.000 Migranten, die nach Quoten auf die anderen EU-Länder verteilt werden sollten. Doch erst 2.350 Migranten sind tatsächlich bis Ende 2016 von Italien in andere EU-Länder weitergeleitet worden. Da sich vor allem Osteuropa weigert, Migranten aufzunehmen, Österreich eine Obergrenze eingeführt hat und Deutschland und Schweden ohnehin überlastet sind, wird Italien mit der Verdoppelung der Asylbewerberzahlen von 2015 auf 2016 selbst fertig werden müssen. Italien wird praktisch allein gelassen.
Italien schafft das immer weniger, zumal die Regierung diesbezüglich auch weniger Merkelschen Optimismus und deutsche Effizienz zeigt. Erst 2.800 von 8.000 Gemeinden haben Asylbewerber aufgenommen, die Verfahren dauern zwischen 2 und 4 Jahren und rund 60% der Asylanträge werden abgewiesen. Die allermeisten Migranten tauchen dann ab, nur wenige tausend wurden 2016 in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Die Grenzen der Aufnahmefähigkeit dieses Asylsystems werden immer mehr erkennbar. Dabei sind es nicht so sehr finanzielle Lasten für Italien, die zu denken geben, sondern gravierende soziale Probleme für die Migranten selbst, die als Illegale irgendwo ihr Leben fristen. Auch anerkannte Asylwerber tun sich schwer, im kriselnden italienischen Arbeitsmarkt unterzukommen.
Somit hat der neue Innenminister angekündigt, die Asylverfahren zu beschleunigen und die abgelehnten Migranten konsequenter abzuschieben. In jeder Region soll künftig ein Abschiebezentrum entstehen, also auch in Trentino-Südtirol. Dafür werden Rückführungsabkommen mit verschiedenen afrikanischen Staaten geschlossen. Wie Deutschland erhöht Italien den Druck auf die Herkunftsländer, da es aber nur geringe Entwicklungsprogramme mit Afrika unterhält, wird die Drohung der Kürzung der Gelder wenig Eindruck machen. Nun kann ein Asylrecht auf Dauer nur funktionieren, wenn die abgelehnten Bewerber auch das Land wieder verlassen. Geschieht dies nicht, wird das Asylrecht zur Einladung, die Überfahrt zu riskieren, fördert die Erwartung, auf jeden Fall in Italien bleiben zu können. Das Asylrecht ist aber als grundlegendes Menschenrecht politisch Verfolgter und in ihrem Leben Bedrohter entstanden, nicht als Recht auf freie Migration aus Arbeitsgründen. Migration aus Arbeitsgründen bedarf der Steuerung, weil die Integrationsfähigkeit der Aufnahmeländer nicht unbegrenzt ist. Gerade Italien, derzeit das Eingangstor Nr.1 für Asylwerber in die EU, ist überfordert, weil die EU-Asylpolitik nicht funktioniert.
Nun will Innenminister Minniti in allen Regionen ein Abschiebezentrum (Centro di identificazione e espulsione CIE) einrichten, zumindest 18 für jeweils 80-100 abgelehnte Asylwerber. Heute bestehen erst fünf dieser Art, und zwar in Turin, Rom, Bari, Trapani und Caltanisetta. Diese CIE gibt es unter anderem Etikett schon seit 1998, wurden aber immer wieder wegen Ineffizienz und schlechter Führung kritisiert. Wenn Italien das Asylverfahren insgesamt effizienter gestalten will, braucht es diese Zentren. Eines ist es, das Asylrecht gemäß Grundrechten, Flüchtlingskonvention und EU-Recht fair zu regeln, etwas anderes ist dessen konkrete Umsetzung.
Alle EU-Staaten gehen unter dem Druck der Zuwanderung dazu über, die Rückführungen strenger anzupacken: warum gerade Italien nicht? Wenn Italien nun neue CIE-Kapazitäten schafft und damit die abgelehnten Asylwerber besser unterbringt und ihre Rückführung effizienter gestaltet, ist das im Sinne eines Rechtsstaats korrekt. Damit verschafft sich Italien auch etwas Luft, um andererseits die anerkannten Asylwerber und Migranten besser zu integrieren. Somit ist auch die Schaffung eines Abschiebezentrums in der Region Trentino-Südtirol folgerichtig und jenes in Roverè della Luna geplante – wie gestern von SALTO berichtet - hat seine Berechtigung. Warum sollte sich gerade unsere wohlhabende Region ihrer Verantwortung für die Umsetzung des Asylrechts entziehen können?
SALTO, 19.1.2017
ITALICUM
Il minimo indispensabile„La Corte ha fatto solo il minimo indispensabile”, ha commentato ieri Enzo Palumbo la sentenza della Consulta sull’ITALICUM, uno degli avvocati promotori del ricorso di 5 tribunali contro le legge elettorale per la Camera del 2015. Per fortuna questi avvocati si erano mossi insieme al Coordinamento per la Democrazia costituzionale prima della sua applicazione. perciò la legge n.52/2015 è stata sottoposta al controllo di costituzionalità prima della sua applicazione e non dopo tre turni elettorali come il PORCELLUM (2006, 2008 e 2013) portando a tre Parlamenti eletti con una legge elettorale incostituzionale.
La Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale il secondo turno di ballottaggio e l’articolo che consentiva al capolista eletto i più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Mentre sono bocciate le pluricandidature, sopravvive invece il premio di maggioranza per chi raggiunge il 40% dei voti (340 seggi assicurati), resistono le candidature multiple, cioè un capolista può essere inserito in più collegi elettorali. Con questo sistema del capolista bloccato buona parte degli eletti saranno di fatto nominati dalla rispettiva centrale di partito. La maggior parte dell’ITALICUM è rimasto intatto.
Da una prospettiva di equità del voto democratico di tutti i cittadini questo verdetto non può soddisfare. Un premio di maggioranza talmente alto discrimina le forze politiche minori, premia rappresenta solo una minor parte dell’elettorato. Il Parlamento deve essere lo specchio delle preferenze politiche dei cittadini. Occorre restituire agli elettori il diritto di scegliersi i propri rappresentanti, e questo non è garantito dall’ITALICUM. Il prossimo sistema elettorale dev’essere di natura proporzionale con una soglia di sbarramento non troppo alta senza eccessivo premio di maggioranza e con la piena libertà degli elettorali di dare preferenze.
Comunque, almeno una parte dell’ITALICUM è caduta. Quindi il Parlamento dovrebbe rifare subito la legge elettorale, unica per entrambi i rami, facendo pulizia degli aspetti incriminati. Il Parlamento non solo deve intervenire per rendere omogeneo il sistema elettorale nelle due Camere, ma potrebbe anche ristabilire il MATTARELLUM o un’altra forma di sistema proporzionale corretto.
SALTO, 26.1.2017
Proposta di legge di iniziativa popolare
L’educazione civica torni materia autonoma28 anni fa l’educazione civica è sparita dai programmi scolastici, trasformandosi in mero „principio di insegnamento trasversale” a tutte le discipline, ma questo poi si è tradotto in nulla di fatto. Forse si pensava che oggi ogni cittadino maturasse questi strumenti e conoscenze per conto suo. Nel 2008/09 nell’ambito della riforma Gelmini è stato tentato di reintrodurre questa materia, definita „Educazione alla Cittadinanza e Costituzione“, senza successo.
Oltre tante voci della scuola ora è l’ANCI, l’associazione dei comuni italiani, a riproporre la sua introduzione come materia con voto autonomo nei curriculi scolastici di ogni ordine e grado. “Non possiamo”, sostiene l’ANCI, “affidare un mattone così importante come la coesione sociale alla spontaneità estemporanea dell’educazione familiare e dei percorsi individuali di educazione non formale.” A questo scopo l’ANCI il 20 luglio scorso ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare che – raccolte 50.000 firme – potrà approdare in Parlamento. La proposta prevede “l’insegnamento di educazione alla cittadinanza come disciplina autonoma con propria valutazione nei curricula e nei piani di istruzione di entrambi i cicli di istruzione.” Rimodulando gli orari delle discipline diritto, filosofia e storia andrebbero ricavate 33 ore annuali di insegnamento. Sono poche di fronte a tante questioni politiche complesse che meritano di più di un’ora per essere affrontate seriamente con mezzi didattici moderni. In Germania nella maggior parte dei Länder alla materia Sozialkunde o Politische Bildung sono riservate almeno due ore settimanali. Spetterà al Ministero dell’Istruzione di elaborare gli obiettivi specifici, la collocazione dell’insegnamento nei curricula, la decisione se optare per un’ora di nuova istituzione o da ricavare nell’ambito dei quadri già esistenti.
Nella Relazione alla proposta di legge (sul sito dell’ANCI) si spiegano con ardore e gran senso di realtà i motivi e le urgenze che rendono improcrastinabile l’introduzione di questa materia scolastica autonoma. Si potrebbe aggiungere che in un’epoca in cui i giovani consumano notizie e messaggi in forma compressa soprattutto attraverso la loro “bolla facebook”, il funzionamento della politica, le regole della vita civile-politica, i problemi politici dei nostri giorni meritano più attenzione con l’aiuto di una materia a se stante. In termini più banali: si tratta di sviluppare più senso critico e imparare a leggere e capire un buon giornale. Inoltre, in Alto Adige si tratta di una materia che si presterebbe bene per l’impiego del metodo CLIL. Cioè una parte potrebbe svolgersi nell’altra lingua per preparare i ragazzi a ragionare insieme ai loro coetanei sui problemi che ci riguardano tutti. Ricordo che i giovani stessi sono perlopiù favorevoli: alla domanda sulla necessità di introdurre una materia specifica dedicata all’educazione alla cittadinanza nel 2016 il 59,4% dei giovani di 16 anni e oltre ha risposto di SI (ASTAT, Indagine sui giovani 2016, p.87).
La necessità di più educazione alla cittadinanza è già stata riconosciuta dal Consiglio provinciale che con la nuova legge sulla partecipazione diretta del 25.7.2018 ha istituito un ufficio apposito per la formazione politica e la partecipazione (art.24 della L.P. 34-2018). Non sarà sufficiente, perché anche la scuola dovrà fare la sua parte. Tutto questo non sarà un toccasana per il populismo dilagante, ma se questo fenomeno è anche dovuto alla mancanza di conoscenze e senso critico, occuparsi in forma didattica di politica anche a scuola è uno dei modi per contrastarlo. La proposta di legge dell’ANCI può essere firmata per altri 4 mesi presso ogni segreteria comunale.
SALTO am 12.9.2018
Wege aus dem Flüchtlingsnotstand
Hot Spots als Lösung?Eigentlich sind es Ferieninseln: Lesbos, Samos und Kos. Doch seit Monaten sind sie eher Rettungsinseln für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Pakistan, die mit Booten über die Ägäis kommen.
Deshalb sollen nun auf diesen drei Inseln sogenannte "Hotspots" einrichtet werden: Anlaufstellen, in denen die Menschen registriert werden, wo ihnen Fingerabdrücke genommen werden und wo es eine erste Prüfung geben soll, ob sie ein Anrecht auf Asyl haben oder nicht. In den "Hotspots" sollen europäische Sicherheitsbehörden für die Registrierung der Flüchtlinge in Griechenland und Italiens sorgen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.
Bis spätestens Ende November sollen diese "Hotspots" in Griechenland und Italien funktionieren, kündigte Frankreichs Präsident François Hollande nach dem EU-Gipfel diese Woche an. Das sind nur noch zwei Monate. Es ist allerdings noch gar nicht sicher, ob das Projekt bis dahin überhaupt sinnvoll umsetzbar ist.
Das EU-Parlament hat sich für Notfallpläne der EU-Kommission ausgesprochen. Darin enthalten die Einrichtung von Hot Spots zur Registrierung von Flüchtlingen. In Catania und ein weiteres auf Lampedusa sind diese bereits eingerichtet. Hier arbeiten Frontex, EUROPOL und EASO (EU-Asylbehörde) mit der italienischen Polizei zusammen. Es soll eine erste Filterung erfolgen von Migranten mit und ohne Schutzanspruch. Erst dann sollen registrierte Migranten gemäß EU-Verteilungsquote umgesiedelt werden. Migranten ohne Bleiberecht sollen abgeschoben werden. In Griechenland sollen weitere Hot Spots eingerichtet werden, weil dort zahlreiche Inseln angelaufen werden. Unklar ist, wie EU-Flüchtlinge an der Weiterreise über den Westbalkan gehindert werden sollen. Die Europäisierung der Aufnahmestrukturen wäre eine weitere Möglichkeit.
Die Erfahrungen Spaniens beim Grenzschutz und in der Zusammenarbeit mit den Transitländern könnten dabei nützlich sein. Spanien war bis vor kurzem auch mit einer hohen Zahl von Migranten konfrontiert. Auf den Kanarischen Inseln kamen 2006 noch 36.000 Migranten an, heute keine mehr. Entscheidend dafür war die Kooperation mit den Herkunfts- und Transitländern. Aufgrund von Abkommen konnte Spaniens Grenzwächter in diese Länder schicken, die zusammen mit Senegals Küstenwache patrouillieren. Gleichzeitig baute Madrid seine Finanzhilfe an diese Länder aus und schuf legale Wege für die Arbeitsmigration, um den Anreiz für die Bootsmigranten zu verringern. Mit anderen afrikanischen Staaten schloss Spanien Rückübernahmeabkommen.
Italien könnte für die Migration aus Libyen gegenüber Arbeitsmigranten ähnlich vorgehen, vorausgesetzt es schafft es, die Hot Spots laut EU-Übereinkunft zu aktivieren und Kriegsflüchtlingen viel schneller Asyl zu gewähren, während Arbeitsmigration andere Kanäle organisiert werden müssen. Das Problem ist in der EU-Außengrenze der Ägäis natürlich ganz anders gelagert, weil dort vor allem Kriegsflüchtlinge aus Nahost übersetzen, die über die Balkanroute nach Deutschland und Nordeuropa wollen. Um hier die Migration in den Griff zu bekommen muss die EU (und die ganze Staatengemeinschaft) zwei eigentliche Hot Spots lösen: den Krieg in Syrien beenden und die Last für die Flüchtlingslager in Jordanien, Türkei und Libanon in gerechtem Ausmaß mittragen. Der derzeitige Flüchtlingsstrom ist ja vor allem eine „nicht quotengeregelte Umsiedlung“ von Flüchtlingen aus der Türkei und Jordanien nach Deutschland. Die Türkei hat zwei der über 4 Millionen syrischen Mit mehr als 2,3 Millionen Flüchtlingen, unter ohne knapp 2 Mio. Syrer, trägt die Türkei die Hauptlast der Massenflucht vor den Kriegen in der Region in Syrien, Irak und Kurdistan. Die Regierung in Ankara hat angeblich 7,6 Mrd. Dollar für die Versorgung der Flüchtlinge aufgebracht (im Vergleich: die EU hat soeben Hilfszahlungen für die Flüchtlingslager in Jordanien, Libanon und der Türkei von 1 Mrd. Euro zugesagt). Die EU bedrängt nun die Türkei um Rücknahme von Flüchtlingen und ein härteres Vorgehen gegen die Schlepper.
Zur Syrienfrage hat die Türkei die richtige Position: ohne einen Sturz des Asad-Regimes, das Krieg gegen das eigene Volk führt mit bisher mehr als 200.000 Opfern, sei kein Frieden denkbar. Ohne eine enge Kooperation mit der Türkei werden auch die EU-Hot Spots in Griechenland nicht funktionieren.
SALTO, 25.9.2015
Verfassungsreform
Zurück zum Zentralismus?Trotz der vielversprechenden Ansätze in der Verfassungsreform von 1999 und 2001 und des Drucks aus dem Norden für mehr Föderalismus steht der italienische Regionalstaat jetzt vor dem rollback. Überraschend, wie wenig Widerstand dagegen aufgeboten wird: keine Barrikaden weder in Mailand, noch in Turin noch in Venedig.
Dabei fällt, wenn die gestern in erster Lesung genehmigte Verfassungsreform nächstes Jahr kommt, diese Rezentralisierung ziemlich heftig aus. In grundlegenden Bereichen hat in den Regionen wieder ausschließlich Rom das Sagen: Grundregeln der öffentlichen Finanzen, Verwaltungsverfahren, Arbeitsrecht der öffentlich Bediensteten. Allgemeiner Gesundheitsschutz, Bildungspolitik, Ergänzungsrentenversicherung, Gemeindeordnung, Außenhandel, geschützte Berufe, Raumordnung und Zivilschutz, Energiewirtschaft, strategische Infrastrukturen. Nicht einmal die Kultur, den Tourismus und den Sport können die Regionen mehr selbst regeln, auch der Landschaftsschutz wird ihnen abgenommen. Das alles fiel bisher unter die „konkurrierende Gesetzgebung“, wandert jetzt aber zurück zum Staat. Um diese Art von Zuständigkeit ist es nicht schade, war sie doch ein Konfliktherd sondergleichen. In einem echten Regionalstaat hätte all diese Regulierungsmacht zu den frei gewählten Regionalparlamenten wandern müssen, nicht umgekehrt. Daran sind freilich die regionalen politischen Eliten nicht unschuldig.
Das ist noch lange nicht alles, denn auch bei den wenigen verbleibenden Zuständigkeiten der Regionen kann sich der Staat viel kräftiger einmischen als bisher. Das sog. Subsidiaritätsprinzip wird sonst immer beschworen: „Was auf unterer (bürgernäherer) Ebene besser geregelt und verwaltet wird, soll Gemeinden und Regionen zufallen“. Es wird jetzt umgekehrt, neues Motto in Italien ist die supremacy clause: „Grundsätzlich macht es der Staat besser, im Ausnahmefall kann er die Verwaltung an die Regionen delegieren.“ Ein Irrweg, der auch die regionale Demokratie aushöhlt.
In diesem Licht ist der neue Senat eine hybride Verlegenheitslösung. Dass Italien sich vom Zweikammersystem verabschiedet und überhaupt Politikerzahl und Politikosten reduziert, war überfällig. Doch eine Regionenkammer sieht anders aus. Die neue „Versammlung der territorialen Institutionen“ wird bei der Gesetzgebung beratend mitmischen, bei Verfassungsänderungen mitstimmen und den Staatspräsidenten mitwählen, aber tritt in sich schon geschwächt an. Was sollen die Regionen groß mitmischen, wenn ihnen vorher per Verfassungsänderung ein Großteil der Zuständigkeiten abgenommen wird?
Zu Recht haben alle Südtiroler Vertreter die zentralistische Ausrichtung dieser Reform kritisiert. Doch politisch hauptverantwortlich dafür ist eben doch der Bündnispartner PD. Die Südtirol-Autonomie wird zwar nicht angetastet, aber für alle Regionen mit Sonderstatut wird es in diesem Szenario enger. „Ein Ausbau der Autonomie wird ein ganz harter Kampf“, sagt Hans Berger in den DOLOMITEN, denn jetzt schon wächst der Abstand zwischen den Normalregionen bei Finanz- und Kompetenzausstattung gewaltig. Das fördert die Konkurrenzsituation zwischen Normal- und Spezialregionen. Gegen einen weiteren Ausbau unserer Autonomie wird sich paradoxerweise die neue Pseudo-Regionenkammer verwehren.
SALTO, 9.8.2014
Rosatellum II
Parteienmacht vor WählerfreiheitDas neue Wahlrecht kommt fast einer Abschaffung des Rechts auf die Abgabe von Vorzugsstimmen gleich, maßgeschneidert für die größeren Parteien.
Die von PD, Forza Italia, NCD und Lega Nord gestern in der Kammer abgesegnete Wahlrechtsreform ist keine demokratische Großtat. Nachdem das Porcellum und das Italicum 2015 und 2017 teilweise für verfassungswidrig erklärt wurden, hätte das Parlament eigentlich ein faires, bürgerfreundliches Wahlrecht schaffen müssen. Stattdessen wird das Recht der Wählerschaft, ihre politischen Vertreter auszusuchen, wieder in hohem Maß eingeschränkt. Fast zwei Drittel der Abgeordneten (399) und Senatoren werden künftig über „blockierte Listen“ gewählt, die von den Parteizentralen vorgegeben werden. Das restliche Drittel der Parlamentarier wird in 231 Wahlkreisen direkt gewählt, wobei die Parteien Listenverbindungen eingehen können. Man wird wieder taktische Wahlbündnisse schaffen, die sich nach dem Wahltag wieder in Luft auflösen oder einige Lockvogellisten mit Parlamentssitzen bedienen. Blockierte Liste heißt: keine Vorzugsstimme, also keine Personenauswahl bei zwei Dritteln der Sitze. Mit dem Einheitsvotum für Direktkandidaten und den nach Proporzsystem zu vergebenden Sitzen, gilt dann die Devise: „Prendere o lasciare“. Eine in anderen Ländern Europas ziemlich unbekannte Regelung.
Überdies wird die Wählerschaft gezwungen, dieselbe Partei oder Listenverbindung zu wählen, zu welcher der direkt gewählte Kandidat gehört. Es wird also keine Zweitstimme nach bundesdeutschem Muster geben, kein Panaschieren. Die Wahl eines direktgewählten Kandidaten geht automatisch auf das Konto der Parteien beim proportionalen Anteil der Sitze (399 in der Kammer). Somit werden die größeren Parteien und mächtigeren Listenverbindungen privilegiert, die bei den Direktwahl-Wahlkreisen abräumen. Kein Wunder, dass die SVP von diesem Wahlrecht sehr angetan ist. Das neue Wahlrecht schafft die Vorzugsstimmen nahezu ab. Das geht zu Lasten der kleineren Parteien und des M5S, im Gegensatz zur Behauptung von Gerhard Mumelter, der auf RAI Südtirol beklagt hatte, dass die Streichung des verfassungswidrigen Mehrheitsbonus Italien wieder unregierbar machen werde.
Eigentlich geht es bei einer demokratischen Wahl auch um die freie Wahl der politischen Vertreter, die halbwegs die Anliegen und Überzeugungen der einzelnen Wähler entsprechen. Die Parteien fühlen sich in normalen Demokratien immer noch bemüßigt, eine gewisse Bandbreite an Männern und Frauen aufzubieten, die dem Wähler eine gewisse Wahlfreiheit lässt. Die Möglichkeit oder gar das Recht auf Vorzugsstimme ist eines der wenigen Mittel in der Hand der Wähler, die Zusammensetzung des Parlaments zu beeinflussen. Fehlt das Recht auf Vorzugsstimme, stellen die Parteizentralen das Parlament nach Gutdünken zusammen. Mit dem Rosatellum II werden die Wähler kaum Chancen auf Auswahl haben. Bestes Beispiel die SVP, die die Parlamentarier im internen Geklüngel auskartet und dann den Wählern vorsetzt. Die gewählten Parlamentarier werden es den Parteibossen zu danken haben, die sie an der jeweiligen sicher Listenplatz gesetzt haben. Der Stabilität der Parteienmacht mag das schon dienlich sein, der demokratischen Wahlfreiheit der Bürger, ihre Vertreter nach Persönlichkeit, Erwartungen, Programmen „vorzuziehen“ sicher nicht.
Nebenbei: dass die Regierung beim Wahlrecht, einer klassischen Zuständigkeit des Parlament, die Vertrauensfrage stellt, scheint geradezu verfassungswidrig zu sein, denn Art. 72, Absatz 4 Verf. besagt: „Das normale Verfahren der Überprüfung und unmittelbaren Annahme durch die Kammer wird immer bei Gesetzesvorlagen angewandt, die Verfassung und Wahlen..…betreffen.“
SALTO, 14.10.2017
Rosatellum II
Politische Grundrechte missachtetDas letzte Woche vom Parlament definitiv abgesegnete neue Wahlrecht macht zwar den Weg frei zu einer Wahl beider Kammern mit einheitlichen Regeln. Doch könnte dem Rosatellum II durchaus dasselbe Schicksal blühen wie dem Vorgängergesetz Italicum, nämlich in Teilen für verfassungswidrig erklärt zu werden. Tatsächlich verletzt dieses von der Regierungsmehrheit und Lega mit Vertrauensfrage durchgedrückten Gesetzes einige politische Grundrechte:
1. Art 48 der Verfassung gibt den Wählern das Recht auf eine freie, gleiche und personenbezogene Wahl der Abgeordneten und Senatoren. Diese freie Wahl von Kandidaten wird von Rosatellum II nicht gewährleistet, weil automatisch die Liste des gewählten Kandidaten auch für jenen Teil der Parlamentssitze als gewählt gilt, der mit Proporzsystem besetzt wird.
2. Im Unterschied zum bundesdeutschen Wahlrecht kann der Wähler seine Stimme zwischen Direktwahl im Einer-Wahlkreis und Proporzwahl im selben Wahlkreis nicht splitten (Zweitstimme). Die Wahl eines Direktkandidaten ist nämlich direkt verknüpft mit dessen Liste für den Proporzwahlbereich, wo es nur „blockierte Listen“ und keine Vorzugsstimmen für Kandidaten gibt. Man wählt die Katze im Sack einfach mit.
3. Das Rosatellum II bringt wie das Italicum „blockierte Listen“ und nimmt damit den Wählern die Vorzugsstimmenwahl. Beim Proporzwahlbereich (399 von 630 Sitzen, also fast zwei Drittel) darf man nur eine Liste ankreuzen. Damit ist die Wahl eindeutig nicht mehr persönlich frei und direkt, unter Verletzung der Verfassungsartikel 48, 49, 51, 56 und 58. Von den Parteizentralen fix vorgegebene Listen verletzen das Grundrecht auf Wahlfreiheit der Bürger und Bürgerinnen.
4. Das Rosatellum II verletzt auch in seinem Zustandekommen die Verfassung, denn mit seiner Verabschiedung im Parlament ist die Vertrauensfrage für die Regierung gestellt worden. Laut Art. 72, Abs.4 Verf., ist für Wahlgesetze wie für Verfassungsgesetze das normale Gesetzgebungsverfahren vorgesehen.
PD und Forza Italia mit Unterstützung von der Lega und NCD störte das nicht, weil sie wohl davon ausgehen, dass die Verfassungswidrigkeit des Rosatellum II Rest nach den Wahlen im März 2018 festgestellt wird, wie schon beim Italicum geschehen. Damit könnte ein mit verfassungswidrigem Wahlrecht gewähltes Parlament wie das amtierende wieder fünf Jahre im Amt bleiben. Die italienische Demokratie macht’s möglich.
SALTO, 3.11.2017
Referendum consultivo
Più autonomia fiscale incompatibile col disavanzo stataleIl messaggio politico che esce dalle urne venete e lombarde del referendum consultivo dell’altro ieri è chiaro: la maggioranza della popolazione di queste Regioni rivendica poteri più forti e competenze più estese per la Regione e una più avanzata autonomia finanziaria. Perciò si conferma il rifiuto netto dello stesso elettorato del disegno di riforma costituzionale di stampo renziano tagliare poteri alle Regioni del dicembre 2016. Questo intento ora le delegazioni regionali lombardo-venete dovranno tradurre in proposte concrete sul tavolo delle trattative col Governo a Roma.
Ottenere un più ampio controllo del gettito fiscale riscosso sul proprio territorio è uno degli obiettivi centrali del regionalismo di stampo leghista e di altre forze autonomiste in Italia. In fondo si tratta di riesumare il vecchio progetto di federalismo fiscale, arenatosi con la crisi finanziario e dell’Euro del 2008. Sarebbero quasi 100 miliardi il residuo fiscale (la differenza fra entrate pubbliche complessive regionalizzate meno il totale delle spese pubbliche riferite allo stesso territorio) delle Regioni a statuto ordinario del Nord, fra cui la sola Lombardia contribuisce con 54 miliardi di Euro (CGIA Mestre). Quindi un’enorme massa finanziaria con cui il Nord finanzia lo Stato centrale e copre i disavanzi delle Regioni del Sud. Anche le Regioni a statuto speciale attualmente vantano un residuo fiscale netto positivo, quindi versano di più allo Stato di quanto incassino, ma in una misura molto più modesta.
Arginare questo flusso di risorse verso lo Stato, rafforzare la responsabilità finanziaria del Sud e aumentare le risorse sotto controllo regionale – da una prospettiva di regione speciale che già dispone di questo diritto - è una domanda legittima, ma comunque difficile da realizzare. Questo non tanto per la cattiva volontà del governo, ma soprattutto per il deficit cronico del bilancio dello Stato. Con quasi 2.300 miliardi di debiti accumulati e il quantitative easing in progressivo esaurimento lo Stato non ha gran spazio di manovra per lasciare una fetta consistente delle entrate tributarie alle Regioni del Nord. Nel 2016 la “bolletta” per il servizio interessi sul debito pubblico italiano ha superato i 70 miliardi di euro.
Il federalismo fiscale fa a pugni con la solidarietà interregionale, fin quando il divario Nord-Sud si presenta talmente incancrenito come è il caso in Italia. Purtroppo in 70 anni di Repubblica, nonostante il gran flusso di risorse pubbliche, non si è ridotto decisamente. Federalismo fiscale non significherebbe solo il diritto delle Regioni di trattenere una fetta più ampia del gettito fiscale (dei tributi statali) riscosso sul proprio territorio, ma anche qualche competenza in più per regolamentare i tributi più importanti, intervenendo sulle aliquote dell’IRPEF, dell’IRPEG, dell’IVA o magari introducendo un’imposta aggiuntiva come quella sull’eredità e le successioni. Quest’ambizione al momento non viene neanche soddisfatta nei confronti delle Regioni a statuto speciale, perché lo Stato fa di tutto per mantenere un sistema tributario unitario sia per non creare situazioni di “dumping” fra le Regioni, sia per non perdere quote del gettito urgentemente richieste per ridurre il deficit pubblico. In fin dei conti, anche se la Lombardia e il Veneto riuscissero a farsi attribuire qualche competenza in più, il salasso annuale finanziario verso il Centro – quantificato dal CGIA di Mestre con 5.511 Euro a testa per i lombardi e con 3.733 Euro per i veneti – non si ridurrà sostanzialmente.
SALTO, 24.10.2017
Die Senatsreform
Weniger Spesen, wenig Einfluss der RegionenDie Abschaffung des perfekten Bikameralismus war zwar überfällig, doch die Regionen gewinnen nicht wirklich an Macht im politischen System mit einem neuartigen Organ, das schon als „Debattierklub“ abgetan wird. Immerhin soll diese Senatsreform eine halbe Milliarde Euro an Politikkosten einsparen.
Der neue Senat vertritt die Regionen und Lokalkörperschaften, d.h. vor allem die Gemeinden. In der vagen Formulierung des Art.1 der Reform trägt der Senat zur Bildung der Gesetze und EU-Normen, sowie zur Bewertung der Politik und Verwaltung des Staats bei. Die Mitglieder des künftigen Senats werden, laut Art. 2 des Entwurfs der Verfassungsreform, direkt von den Regionalräten bestimmt. In Südtirol werden diese Aufgabe der Landtag (für das Landtagsmitglied) und der Rat der Gemeinden (für den Bürgermeister) übernehmen. Ihre Senatsmitgliedschaft fällt zeitlich mit jenem ihres eigentlichen Mandats zusammen. Das Landtagswahlgesetz wird die Modalitäten festlegen, wie der Südtiroler Senator bestimmt wird. Der vom Landtag zu nominierende Senator – ein Landtagsabgeordneter – könnte für diese Funktion auch einen speziellen Wählerauftrag erhalten, indem die wahlwerbenden Listen unter ihren Kandidaten einen als künftigen Senator zur Wahl stellen. Damit erhielte er oder sie eine gewisse demokratische Legitimation für dieses Amt. Da der Rat der Gemeinden als zweiten Senator einen Bürgermeister der italienischen Sprachgruppe benennen muss, wird es voraussichtlich der Bozner Bürgermeister sein.
Der neue 100-köpfige Senat wird aus 74 Regionalrats- bzw. Landtagsabgeordneten, 21 Bürgermeistern und 5 vom Staatspräsidenten ernannten Personen zusammengesetzt sein. Letzteres ein überholtes Relikt aus der Zeit der Honoratiorenparlamente. 21 Bürgermeister sind es, damit auch das Trentino und Südtirol getrennt ihren „wichtigsten“ Bürgermeister platzieren können.
Die Doppelrolle der neuen Senatoren drückt gleichzeitig die stark geschrumpfte Bedeutung des Senats aus: da sie eigentlich vielbeschäftigte Stadt-Bürgermeister und Regionalpolitikerinnen sein werden, werden sie wohl nur einige Tage im Monat in Rom nach dem Rechten sehen können. Das spart zwar Politikerdiäten, reduziert aber sowohl die demokratische Legitimation des Amts wie die konkrete Möglichkeit, eine Kontrollfunktion der parlamentarischen Arbeit aus regional-kommunaler Perspektive auszuüben. Das wäre ohne Zweifel eine Vollzeitaufgabe.
Die regionalistische Alternative wäre es gewesen, die Senatoren bescheiden zu honorieren, sie von der Wählerschaft in Region oder Land direkt wählen zu lassen (relative Mehrheit entscheidet) und ihnen konkrete Aufgaben zuzuteilen, vergleichbar mit jenen einer echten Regionenvertretung der Länderkammer wie dem deutschen Bundesrat. Der indirekte Wahlmodus entspricht aber der Ausrichtung der jetzigen Verfassungsreform, die die Bedeutung der Normalregionen insgesamt abwertet. In Südtirol hilft die Aufteilung der Rollen zwischen einem „Landtags-Senator“ und einem „Bürgermeister-Senator“ auch elegant aus dem Proporzdilemma. Indirekt hat der Bozner Bürgermeister stets ein Votum des größeren Teils der italienischen Sprachgruppe, während der „Landtags-Senator“ die stets deutschsprachige Mehrheit des Landtags hinter sich haben muss.
Der Senat wird durch diese Reform schon fast zum bloß beratenden Organ degradiert. Vom Vertrauensvotum gegenüber der Regierung wird er entbunden, echt mitbestimmen kann er nur mehr bei Verfassungsreformen, der Regelung der Referenden (das macht Italien alle 40 Jahre), Wahlgesetzen der Gebietskörperschaften, dem Familienrecht, Gesundheitswesen und internationalen Abkommen. Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Senatoren kann er Abänderungsanträge auch zu anderen Gesetzen vorlegen, die im Parlament behandelt werden. Nur bei der Regelung der Zuständigkeiten der Regionen und Lokalkörperschaften hat der zukünftige Senat mehr Gewicht. Entsprechende Abänderungsanträge des Senats können nur mit absoluter Mehrheit der Parlamentsmitglieder abgelehnt werden.
Eine proportional stärkere Vertretung Südtirols im Senat ist zwar gesichert, wie Karl Zeller unterstreicht, aber in einem insgesamt wesentlich schwächeren Organ. Von einer echten Regionenkammer ist dieser Senat weit entfernt. Für Südtirol insofern weniger tragisch, als die Beziehungen Rom-Bozen im Weg des „metodo pattizio“ ohnehin stark bilateral gestaltet werden. Doch die mit der gesamten Verfassungsreform einhergehende Schwächung der Regionen ist für Italien insgesamt ein gewaltiger Rückschritt, auch in demokratischer Hinsicht.
SALTO, 9.10.2015
Die Kosten des Regierungsprogramms
Ein unfinanzierbarer SpagatAuf 65 bis 125 Milliarden werden die Kosten der Umsetzung des „Regierungsvertrags“ von M5S und Lega geschätzt, während die Gegenfinanzierung ziemlich vage bleibt.
Carlo Cottarelli, ex-Kommissar der spending review, kommt auf mindestens 108,7 Mrd. Mehrkosten, der Corriere della Sera schätzt sie auf mindestens 65 Milliarden. Am stärksten schlägt die Einführung der flat tax zu Buch, die vor allem die oberen Kategorien der IRPEF-Steuerpflichtigen entlasten wird (26 Mrd.). Die „Bürgereinkommen“ genannte Mindestsicherung für Arbeitslose und Armutsbetroffene erfordert mindestens 17 Mrd. Der Verzicht auf eine weitere IVA-Erhöhung, von der Berlusconi-Regierung schon 2011 beschlossen, kommt mit 12,5 Mrd. zu stehen. Die Gegenreform der Fornero-Pensionsreform wird den Staat mindestens 8 Mrd. kosten, der Verzicht auf die Akzise auf Erdölprodukte 6 Milliarden.
Zur Gegenfinanzierung dieser 65-108 Mrd. an Mehrkosten für den Staat bleibt der Vertrag vage. Wenn die geplanten Maßnahmen ein höheres Wirtschaftswachstum bewirken, könnte sie 40 Mrd. an Zusatzeinnahmen bei den Steuern generieren, hofft man. Doch das ist eher eine Hoffnung als seriöse Schätzung. Lega und M5S wollen Verschwendungen bei den Staatsausgaben, z.B. bei den Politikkosten, abbauen. Doch damit lassen sich keinesfalls 65 Mrd. aus dem Hut zaubern. Es läuft somit auf eine höhere Neuverschuldung hinaus, obwohl Lega und M5S zugesichert haben, dass sie die durch die Währungsunion gesetzte 3%-Grenze für die Neuverschuldung einhalten wollen.
Das Staatsdefizit in einer Phase des Aufschwungs zu erhöhen, ist leichtsinnig. Damit erhöht sich der Gesamtschuldenquote über die heutigen 130% des BIP weiter. Da Italien bei diesem Kurs wegen erhöhtem Risiko unweigerlich höhere Zinsen auf die Staatspapiere bieten muss, werden auch die Ausgaben für den Zinsendienst (2017: über 60 Mrd.) steigen. Wenn die quantitative Lockerung der EZB mit 2018 endet, wird es ohnehin finanziell enger für Italien. Mit höheren Schulden hat es Italien in Zukunft schwerer, bei echtem Bedarf in einer Rezession die Staatsschulden hochzufahren. „Keynesiamismo straccione“ nennt man diese Linie in Italien. Die Mindestsicherung müsste durch Steuern, wie z.B. aufs Finanzvermögen, gegenfinanziert nicht durch unsinnige Steuererleichterungen unterminiert werden.
Natürlich ist dieses Programm eine Kampfansage an die EU und eine quasi-Verabschiedung vom Euro-Stabilitätspakt. Italien hat sich verpflichtet, seine Gesamtverschuldung zurückzufahren und nicht weiter zu erhöhen. So verlangt die EU, die Pensionskosten (heute 15% des BIP Italiens) weiter zu senken, nicht zu erhöhen. Die Rechnung für die höhere Staatsverschuldung bezahlen letztendlich auch die sozial Schwächeren: mehr Zinslasten bedeuten auch weniger Mittel für Gesundheitswesen, Bildungssysteme, Forschung, neue Regionenkompetenzen, Sozialdienste, wichtige Infrastrukturen. Eine Mindestsicherung für Armutsbetroffene muss ein europäischer Sozialstaat bieten, kein Zweifel. Auch eine Mindestrente, die es sogar in reicheren Euroländern nicht gibt, ist wichtig. Doch wird die flat tax genau jene Mittel aufbrauchen, die dafür benötigt werden. Dieses Regierungsprogramm ist widersprüchlich, zu teuer und riskant. Widersprüchlich, weil sie die „moglie ubriaca e la botte piena“ wollen. Da werden die positiven Ansätze zwangsläufig auf der Strecke bleiben, weil sie zwischen Finanzmarktdruck und bestehenden Ausgabenverpflichtungen unfinanzierbar sind.
SALTO, 24.5.2018
Gemeinde-Wahlrecht
Ein Schlagbaum vor dem RathausEigentlich ist es ein Gebot der Demokratie, möglichst alle auf Dauer in einem Gebiet lebenden Bürger in den politischen Willensbildungsprozess einzubeziehen.
Die Realität sieht anders aus. Bei den letzten Gemeinderatswahlen blieben viele Wahlberechtigte freiwillig den Urnen fern, die meisten Zuwanderer allerdings gezwungenermaßen. Während die EU-Bürgerinnen seit 1996 bei den Kommunalwahlen in Italien das Wahlrecht haben – es aber kaum nutzen – haben die Nicht-EU-Bürger gar kein Wahlrecht, gleich ob sie 5 oder 25 Jahre hier leben, arbeiten und Steuern zahlen. Dies sind aber zwei Drittel der fast 50.000 in Südtirol lebenden Ausländer. Kann ein so großer Teil der Bevölkerung auf Dauer von den zentralen politischen Rechten ausgeschlossen bleiben?
Italien gehört mit Deutschland und Österreich zur Minderheit der rund zehn EU-Länder, die Nicht-EU-Ausländern auch nach langem legalem Aufenthalt kein Wahlrecht auf keiner Ebene gewähren. In 12 Ländern haben Nicht-EU-Ausländer das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen, meistens nach 4 Jahren Ansässigkeit. In weiteren EU-Ländern wie Großbritannien, Malta und Tschechien haben Drittstaatsangehörige aus ganz bestimmten Ländern das Wahlrecht. So finden sich Millionen Ausländer in der EU in der paradoxen Situation, dass sie auch nach Jahrzehnten Ansässigkeit in der EU noch im Herkunftsland wählen, wo sie längst nicht mehr leben, aber hier, wo sie leben, noch nie gewählt haben. In Italien liegt für Nicht-EU-Ausländer vor dem Rathaus eine Art Schlagbaum. Als einige Städte wie Genua, Ancona, Turin haben versucht, das Wahlrecht auf diese Menschen auszudehnen, ist dies von der Regierung prompt annulliert worden, weil die staatsrechtliche Grundlage fehlt.
Das muss nicht so sein, denn selbst die EU hat die Integration der Ausländer auch im politischen Leben gefordert. Unionsbürger haben laut Unionsvertrag das aktive und passive Wahlrecht im Wohnsitzland bei Kommunalwahlen und EU-Wahlen. Als Bürgermeisterin kandidieren dürfen sie allerdings nicht. Dafür müssen sie sich in die Wählerlisten eintragen lassen, was in Deutschland automatisch geschieht, in Italien nur auf Antrag. Trotz eigener schriftlicher Einladung durch die Wahlämter verzichten dennoch sehr viele darauf. Nicht-EU-Ausländerinnen haben weder aktives noch passives Wahlrecht. So kann man von einem Drei-Klassenwahlrecht der Wohnbevölkerung sprechen, was für eine inklusive Demokratie wohl kaum förderlich ist.
Ausländer, die in Bozen und Meran ansässig sind, können zwar Beiräte wählen, die nur beratende Funktion haben. Ausländer können dort begrenzt mitreden, werden manchmal gehört, können nie mitentscheiden. Die Wahl der Beiräte, deren Neuwahl jetzt ansteht parallel zur offiziellen Amtsperiode, schafft zwar etwas demokratische Legitimation. Später sind die Beiräte von Bozen und Meran in der Politik kaum mehr präsent. Die Wahlbeteiligung ist niedrig und wird niedrig bleiben, denn diese Beiträte haben einfach zu wenig zu sagen. Der Kontakt zwischen Gewählten und Wählern ist schwierig, die Wahl orientiert sich „naturgemäß“ meist an den Herkunftsländern. Ihr größtes Manko ist die mangelnde Beschlusskompetenz. Der Bozner Beitrat hat nicht einmal ein eigenes Mini-Budget noch direkte, von der Gemeinde gebotene Weiterbildung. Gefragt wäre eine echte Beratungs-, Mitsprache und Mitentscheidungsbefugnis. Ansonsten sind solche Beiräte keine Alternative zum Wahlrecht.
Im Parlament in Rom sind eine ganze Reihe von Anläufen gemacht worden, die Verfassung (Art. 48) so abzuändern, dass auch Ausländer das Wahlrecht erhalten können. Bisher erfolglos, denn man setzt derzeit eher auf Anreize zur Einbürgerung. Auch diese ist in Italien ziemlich langwierig. Nun treten zwar immer mehr eingebürgerte Personen zu Wahlen an – einzelne wie Kyenge werden gar Ministerin – auch bei den letzten Wahlen in verschiedenen Gemeinden Südtirols. Doch die politische Gleichberechtigung auf kommunaler und auf Landesebene wird noch nicht einmal diskutiert. Hätten Ausländer das Wahlrecht bei Gemeindeahlen wäre die Beteiligung und Mitverantwortung der Zuwanderer wesentlich höher, abgesehen von dem symbolisch wichtigen Akt der Anerkennung. Hätten die Ausländer das Wahlrecht bei Landtagswahlen, würde die Aufmerksamkeit der Parteien für die Anliegen der Ausländer sprunghaft steigen.
SALTO, 3.6.2015
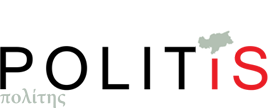
![[[Slogan]]](img/logo_slogan.png)

