Autonomie und Südtirolfragen
EBI “Minority SafePack” abgelehnt
Ein Affront gegen Minderheitenrechte in EuropaDie EU-Kommission zeigt Millionen von Angehörigen nationaler und sprachlicher Minderheiten in der EU die kalte Schulter. Eine arrogante und unverständliche Entscheidung.
In Sachen Schutz ethnischer und sprachlicher Minderheiten ist die EU-Kommission dieses Jahr denkbar schlecht gestartet. Am 14. Jänner 2021 hat sie entschieden, im Sinne der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) “Minority SafePack” nichts zu unternehmen. Mehr als eine Million EU-Bürger:innen – vor allem Minderheitenangehörige und Ungarn – hatten 2017-18 dieses Volksbegehren unterschrieben. Die SVP hatte den Antrag in Südtirol stark verbreitet, worauf es gelang, auch in Italien die erforderliche Mindestzahl an Unterschriften von 50.000 zu erreichen. Diese EBI verlangte von der EU, mehr Mittel für den Schutz ethnischer Minderheiten einschließlich der Roma aufzuwenden, für deren Gleichberechtigung in den Mitgliedstaaten zu sorgen und ein europäisches Zentrum für Sprachenvielfalt zu gründen. Das Europäische Parlament hatte diesen Vorschlag 2020 mit einer Drei-Viertel-Mehrheit gebilligt und sogar der Deutsche Bundestag hatte im November 2020 die Initiative ausdrücklich unterstützt.
Namens des Hauptträgers dieser EBI, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN), kommentierte deren Präsident Loránt Vincze, MEP für die Partei der Ungarn in Rumänien, diese Entscheidung folgendermaßen: „Die Kommission hat den Vorschlag jener Menschen abgelehnt, für welche die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Erbes Europas nicht bloß ein wohlfeiler Slogan ist, sondern eine tägliche Herausforderung ist. Die Kommission hat für uns nur ein billiges Schulterklopfen übrig, während 1,123.422 Unterzeichner konkrete Maßnahmen erwarten. Die Kommission lässt damit rund 50 Millionen EU-Bürger im Stich, die nationalen oder sprachlichen Minderheiten angehören. Millionen von ihnen haben keine echte Gleichberechtigung in ihrem Land. Die EU hielten sie für den Wächter der Demokratie, des Rechtsstaats, von Würde und Gerechtigkeit. Doch nun zeigt ihnen die EU die kalte Schulter“ (vgl. Hungary Today, 18.1.2021). Das MEP Sijbe Knol sagte namens der Europäischen Freien Allianz, die mit den GRÜNEN seit 1999 im EP eine gemeinsame Fraktion bildet: „Es ist skurril, dass die EU-Kommission diese Bürgerinitiative einfach ignoriert. Die Antwort der Kommission ist arrogant und schadet der demokratischen Legitimation der gesamten EU.“
In Reaktion auf diese Entscheidung der EU-Kommission hat die GfbV-Südtirol einen offenen Brief an den Landtag und an den Regionalrat Trentino-Südtirols gerichtet, worin sie die Abgeordneten auffordert, es dem Parlament des Frieslands (NL) gleichzutun. Sie sollten sich offen gegen die Ablehnung dieser EBI seitens der EU-Kommission stellen und klar stellen, dass die Unterzeichner und 50 Millionen Angehörige von Minderheiten in der EU diesen Entscheid nicht einfach widerstandslos hinnehmen wollen.
SALTO, 23.2.2021
Europ. Bürgerinitiative
Mehr EU-Förderung für Regionen mit ethnischen MinderheitenWie kann die EU die Sprachminderheiten fördern? Wie sollen deren Regionen wirtschaftlich gestützt werden? Mit online-Zeichnung dieser EBI kann die EU-Kommission zum Handeln angeregt werden.
Ziel dieser Europäischen Bürgerinitiative (EBI) ist die stärkere Förderung von Gebieten mit Sprachminderheiten: die sog. Kohäsionspolitik – früher regionale Strukturpolitik – soll Regionen mit nationalen, ethnischen, kulturellen, religiösen oder sprachlichen Besonderheiten, die sich von denen der umliegenden Regionen unterscheiden, besondere Aufmerksamkeit widmen.
Nun ist die EU kraft der Unionsverträge verpflichtet, ihr kulturelles Erbe und ihre sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erhalten, hat aber keine unmittelbare Kompetenz zur Förderung der Minderheiten. Besonders benötigt wird diese Förderung dort, wo nationale Minderheiten keinerlei Art von Autonomie genießen und der Minderheitenschutz generell schwach ausgebildet ist. So leiden oft Regionen mit Minderheiten an hoher Abwanderung und Strukturschwäche. Darum soll das übergeordnete Ziel der Erhaltung kultureller Vielfalt auch in der konkreten EU-Förderungspolitik direkt Niederschlag finden. Regionen mit nationalen Minderheiten sollen besonders gefördert werden und besseren Zugang zu den Fördermitteln aus dem EU-Regionalfonds erhalten.
Die Promotoren dieser EBI gehen davon aus, dass die Kohäsionspolitik der EU eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung der Kulturen in Minderheitenregionen spielt. Ihr wirtschaftliches Potenzial soll mit EU-Fördermitteln besser ausgeschöpft werden. Bei der Bildung der NUTS-Regionen innerhalb der Mitgliedsländer zur Abwicklung der EU-Projekte sollen auch sprachliche, ethnische und kulturelle Grenzen beachtet werden. Mehr Informationen dazu hier.
Die Initiative dafür ist vor allem von den ungarischen Minderheiten in Rumänien, in der Slowakei und von Ungarn selbst sowie von Katalonien und dem Baskenland ausgegangen. Getragen wird diese EBI von einem internationalen Promotorenkomitee, vor allem von den Parteien der ungarischen Minderheit in Rumänien, die Ungarn der Slowakei, einer katalanische Organisation, der EFA-Parteienfamilie, und durch die FUEN, den Fachverband der Volksgruppen und nationalen Minderheiten in Europa. Bisher haben schon 1.031.000 EU-Bürger (Stand 19.10.2020) unterzeichnet, womit die Hürde von einer Million Unterschriften genommen wäre. Doch in nur drei Mitgliedsländern ist das Quorum erreicht worden. Wenn dieses Quorum nicht in mindestens 7 EU-Mitgliedstaaten erreicht wird, kann die EBI nicht der EU-Kommission vorgelegt werden. In Italien, wo 54.000 Unterschriften zusammenkommen müssen, sind bisher nicht einmal 1000 eingegangen.
Diese EBI kann in weniger als einer Minute über die EU-Webseite für Bürgerinitiativen unterzeichnet werden. Allerdings muss das rasch geschehen, den die Frist verfällt am 7. November 2020. Hier der Link zum Unterschreiben.
SALTO, 19.10.2020
„European School“ gefordert
Europäisch oder Englisch?„Mehr Europa in der Schule“ titelt die DOLOMITEN am 19.2.2020 zur Tagung des Unternehmerverbands über eine „European School“ in Bozen. Konkret schlägt der UVS die Schaffung einer English School vor, in erster Linie für die Kinder der aus aller Welt kommenden Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen des UVS, aber auch für Südtiroler Kinder, die einen „internationaleren Weg einschlagen wollen“ (Heiner Oberrauch). Da ist viel die Rede von der „Öffnung für andere Kulturen, die für Südtirols Zukunft unabdingbar ist“, als wäre dieses Land bisher ein Teil Nordkoreas gewesen. Doch rasch wird klar: es geht einfach um eine Schule mit viel Englisch, die Kinder für englischsprachige Studiengänge im Ausland fit macht und eine Karriere in irgendeinem global tätigen Multi befördert. Was ist das „Europäische“ an diesem Bildungskonzept? Kann man eine englischsprachige Ausbildung kurzerhand mit einer „Europäischen Schule“ gleichsetzen?
Wenn heute überall das Bildungsziel Mehrsprachigkeit propagiert wird (zu Recht), muss auch gefragt werden: „Welche Mehrsprachigkeit?“ und: „Was ist europäisch?“ Die EU selbst hat als Bildungsziel für den Spracherwerb die Devise „Muttersprache+2“ ausgegeben, was die Mitgliedstaaten insofern übernommen haben, dass in den staatssprachlichen Standardschulen der Fremdsprachenunterricht verstärkt wurde. Die EU hat von den Mitgliedsländern nie verlangt, überall Englisch als Unterrichtssprache einzuführen. Flächendeckend Englisch als Unterrichtssprache einzuführen geht zu Lasten von europäisch verstandener Mehrsprachigkeit.
Doch hinter der „European School“, wie sie jetzt auch der UVS betreibt, verbirgt nichts weiter als das Anliegen, noch mehr Englisch in den Schulunterricht zu bringen. Die „European School“ ist im Klartext eine „English School“ mit den lokalen Sprachen als schmückendes Beiwerk. Dabei wird heute schon der zweiten Landessprache und dem Englischunterricht in Südtirols Schulsystem viel Platz eingeräumt. Weitere Fragen drängen sich auf:
- Warum sollte sich die Südtiroler Schule aller drei Sprachgruppen den Interessen einer mobilen auswärtigen Elite an globaler Verwertbarkeit von Bildung unterwerfen?
- Warum sollte das in zwei großen europäischen Sprachen und einer lokalen Minderheitensprache gut funktionierende Bildungssystem durch englische Schulen ergänzt werden und sich dadurch einer unnötigen Konkurrenz aussetzen?
- Kann man einigen für einige Zeit in Südtirol beschäftigten Businessleuten abverlangen, sich den kulturellen Rahmenbedingungen einer Region anzupassen, oder muss sich auch das öffentliche Bildungssystem den Zwängen der Globalisierung unterwerfen?
- Wo gibt es in Italien oder im deutschen Sprachraum öffentliche oder öffentlich subventionierte Schulen in englischer Sprache?
Wenn Spracherhalt ein kulturpolitisches Grundanliegen ist, Schulen in der Muttersprache ein Grundrecht und jede Sprache ein kulturelles Vermächtnis in sich trägt, muss die von der EU propagierte Mehrsprachigkeit als Bildungsziel anders verstanden werden als nur die wohlfeile Forderung nach mehr Englisch. Europäisch bedeutet zum einen, dass die 24 Amtssprachen der EU (Staatssprachen) ihre Rolle und Bedeutung behalten können, nämlich als Standardsprache der öffentlichen Schulen verwendet zu werden. Zum anderen, dass die EU und die Mitgliedstaaten auch für den Erhalt und die Förderung der Regional- und Minderheitensprachen mitverantwortlich sind, denn um den Unterricht in den Regional- und Minderheitensprachen in der EU steht es heute gar nicht so gut. Nichts gegen Ausbau und Verbesserung des Englischunterrichts, um die globale lingua franca kommt bald niemand mehr herum. Doch in welchem Maß und auf Kosten aller übrigen Sprachen? „Einheit in der Vielfalt“ lautet das Motto der EU, nicht Englisch über alles. Wer Vielfalt begrüßt, muss sie auch erhalten. BBD, 28.2.2020
6er-Kommission demokratisch ausreichend legitimiert?
Seit voriger Woche ist die 6er-Kommission wieder im Amt und das hat lange gedauert. Erst zwei Jahre nach der Parlamentswahl wird ein Organ bestellt, das für die Anwendung der Autonomie eine herausragende Rolle spielt. Sie mag jetzt fachlich gut besetzt sein, doch ist sie für ihre Aufgabe demokratisch legitimiert?In der 6er-Kommission wird nicht nur über kleine Details der Interpretation und Anwendung des Autonomiestatuts entschieden, sondern auch über die Abänderung bestehender Durchführungsbestimmungen und die Weiterentwicklung der Autonomie beraten. In diesen Kommissionen konkretisiert sich das Verhandlungsprinzip zwischen Staat und Autonomen Provinzen, doch kann sich dies nicht in bloß bilateralen Verhandlungen zwischen Regierungen erschöpfen.
Die Paritätischen Kommissionen haben in der Praxis nicht nur eine beratende Rolle, sondern eine rechtsetzende Funktion. Sie erarbeiten die famosen Durchführungsbestimmungen, die als Gesetzesvertretende Dekrete von der Regierung verabschiedet werden. Meist segnet die Regierung Texte ab, die von sechs nur zum Teil gewählten Personen abgefasst worden sind. Eigentlich eine typisch parlamentarische Kommissionsarbeit, hier aber von einer gemischten Politiker-Fachleute-Kommission geleistet. Welche politische Legitimation hat aber irgendein Anwalt aus Bozen oder Rom? Warum haben die Parlamente keine Kontrollfunktion oder Anhörungs- und Informationsrechte?
Die Durchführungsbestimmungen stehen in ihrer Rechtsnatur über einem Landesgesetz und einem normalen Staatsgesetz und können auch nur über eine neue DFB abgeändert werden. In der Geschichte ist fast keine DFB vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten und gekippt worden, auch weil diese Normen Kompromisse zwischen Bozen, Trient und Rom waren. Das mag zwar effizient sein, demokratisch ist es nur mit Einschränkungen. Denn eigentlich wäre die Rolle der Vermittlung und Anpassung des Autonomiestatuts der sog. 137-Kommission zugekommen, besetzt mit gewählten Abgeordneten. Diese Kommission ist bis heute auf dem Papier geblieben.
Auf die Verabschiedung einer Durchführungsbestimmung durch die Regierung erfolgt keine Debatte im Landtag, geschweige denn eine Ratifizierung. Kein Oppositionsvertreter kann sich mit Einwänden melden. Das einzig gewählte Organ des Landes, der Landtag, wird in diesem Verfahren einfach übergangen. Fachleute können beraten, kein Zweifel, doch die Rechtsetzung muss in einem politischen Organ erfolgen. In diesem Sinn sind die paritätischen Kommissionen demokratisch zu wenig legitimiert.
Die Reform der Paritätischen Kommissionen ist überfällig, wenn man diesem rechtsetzenden Organ mehr demokratische Legitimation verschaffen will. Erhielte sie eine breitere Basis, eine pluralistischere Zusammensetzung und mehr Transparenz im Verfahren, könnte ihr Aufgabenbereich erweitert werden, z.B. auf die Vorab-Schlichtung von Zuständigkeitskonflikten zwischen Staat und Land, auf die Mitwirkung der Länder in der EU-Politik, auf die Mitbestimmung bei Staatsgesetzen, die Landeszuständigkeiten berühren.
BBD, 17.2.2020
EURAC-Servicestelle für Autonomie
Ein neues Schaufenster auf eine unvollständige AutonomieMit Beschluss der Landesregierung ist bei der EURAC eine neue „Servicestelle für Südtirol-Autonomie“ eingerichtet worden. Damit sollen die vielen auswärtigen Delegationen, die das Südtirol-Modell Jahr für Jahr kennen lernen wollen, besser bedient werden. Eine wichtige und nützliche Aufgabe, die von der EURAC ohnehin schon seit Jahren wahrgenommen wird. Mit einem stattlichen Zusatzbudget soll das Südtiroler Autonomiemodell damit noch wirksamer bekannt gemacht werden. Dem dafür beauftragten Koordinator ist alles Gute zu wünschen. 150.000 Euro sind gut investiert, wenn Politiker, Forscherinnen und Journalisten aus Krisenregionen hier sehen, wie sich Konflikte friedlich lösen lassen, Minderheiten halbwegs geschützt und eine gemeinschaftliche Selbstregierung eingerichtet werden kann. Man könnte ähnliche Ressourcen freilich auch dem Südtiroler Landtag wünschen, der aus Mangel an Geld, Räumen und Personal die ihm 2018 per Gesetz (L.G. Nr.22/2018, Art.24) übertragene Aufgabe eines Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung noch nicht wahrgenommen hat.
Was bei diesem Export von Know How zur Autonomie hoffentlich nicht zu kurz kommt, ist der realistische und kritische Blick auf unsere Autonomie. Bei allen Errungenschaften gibt es in der politischen Praxis immer noch viele Hindernisse und bei der Reform des Statuts gar einen Stillstand. Ein Rechtsgutachten zu den Entwicklungen der Südtirol-Autonomie seit der Streitbeilegungserklärung (Autoren: Prof. Esther Happacher, Prof. Walter Obwexer, 2017) hat aufgezeigt, wie viele Zuständigkeiten seit 2001 verloren gegangen sind. Als eine SVP-Delegation kürzlich von Giuseppe Conte empfangen wurde, kam als Hauptanliegen seitens der Südtiroler die Wiederherstellung dieser Zuständigkeiten zur Sprache. Kein Thema hingegen die Erweiterung des Umfangs der Autonomie, wie sie vom Autonomiekonvent gefordert worden ist (vgl. Abschlussdokument vom September 2017). In diesem Dokument ist eine Fülle von Vorschlägen zum Ausbau der Autonomie enthalten, die bisher nicht einmal vom Landtag aufgegriffen worden sind. Anscheinend auch kein Thema mehr der Verfassungsgesetzentwurf, den die SVP-Parlamentarier selbst am 23. März 2018 eingebracht haben, der das Autonomiestatut immerhin in der Mehrheit seiner Artikel abändern soll.
Von der Südtiroler Autonomie kann man durchaus als Anschauungsbeispiel viel lernen. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass dieses Modell unvollständig ist. In einem Vergleich der Reichweite der autonomen Befugnisse und des Grads an politischer Selbstbestimmung im Rahmen des Zugehörigkeitsstaats ist Südtirol höchstens im oberen Mittelfeld der bestehenden Autonomien anzusiedeln. Den ausländischen Besuchern muss dies erläutert werden. Ansonsten preist man ein Modell als Non-plus-ultra der Autonomie an, das wohl die Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung längst als unvollständig und unzureichend betrachtet. Ein solches Anpreisen ist wiederum kontraproduktiv, wenn man in Rom einen Ausbau erreichen will.
BBD, 7.2.2020
Benko-Befragung
Benko-Kaufhaus: demokratische Legitimation bleibt fragwürdigAls „Totengräber der direkten Bürgerbeteiligung“ hat RAI-Chefredakteur W. Mayr heute morgens die Kritiker der Volksbefragung zum Benko-Projekt betitelt. Dabei hat das jetzt absehbare Ergebnis der Befragung – rund zwei Drittel für Benko – die Kritikpunkte bestätigt.
So sprechen die Medienvertreter laufend von einer „Wahlbeteiligung“, die angeblich bei 36% lag. Doch gemessen woran? Es konnten und haben höchstwahrscheinlich Pendler aus dem ganzen Land teilgenommen. Diese Personen konnten selbst definieren, worin ihr Pendlertum besteht, also ist die Grundgesamtheit der Abstimmungsberechtigten unbekannt, zumindest solange nicht getrennt die Antworten der Bozner und Nicht-Bozner festgestellt wird. Kurz: man kann gar keine „Wahlbeteiligung“ an dieser reinen Befragung feststellen.
Die wirklich für diese Frage zuständige Bozner Bürgerschaft hatte guten Grund, skeptisch zu sein. Kommissar Penta will das ganze Projekt aufgrund eines mehrheitlichen JA einer reinen Befragung weiterbetreiben. Bei einem Nein hätte er das Ganze an den neuen Gemeinderat weitergereicht. Eine Befragung ist aber nicht dasselbe wie eine bindende Volksabstimmung oder eine beratende Volksabstimmung (Art. 59 Satzung Bozen) mit korrekten Regeln.
Wesentlich für das Pro-Benko-Ergebnis ist natürlich auch die aufwändige Kampagne der Projektbetreiber. Nun lässt es sich auch bei einer guten Regelung der direkten Demokratie nicht vermeiden, dass finanzstarke Verbände und zahlungskräftige Einzelne mit ihrem Geld Meinungsmache betreiben. Umso wichtiger - neben der Offenheit der Medien für alle Kontrahenten - die faire Regelung der Informationspflichten der öffentlichen Hand, gleich ob Gemeinde, Land oder Staat. Doch Kommissar Penta hat sich genau daran nicht gehalten, obwohl alle Gemeinden der Region (Gemeindeordnung, R.G. vom 9.12.2014, Nr.11) verpflichtet sind, allen Wählern solche Broschüren zuzusenden. Penta wird sich damit herausreden, dass es nur um eine Bevölkerungsbefragung ging, wofür diese Bestimmung nicht gilt. Andererseits will er das Ergebnis als bindend bzw. politisch legitimierend für die Absegnung des Projekts betrachten. Unkonsequent und unseriös.
Noch ein Punkt: möchten die Bozner Bürger eine echte Volksabstimmung über das Benko-Projekt unter den in Bozen Wahlberechtigten anstrengen – es ginge nicht! Die Gemeindesatzung, Art. 59, P.5, lässt nämlich urbanistisch relevante Themen für eine Volksabstimmung gar nicht zu. Und Art. 59, P.11, schreibt sogar für eine beratende Volksabstimmung ein Quorum vor:
„11. Wenn sich an einer beratenden Volksabstimmung mindestens 40 % plus eine/ein Wahlberechtigte/r beteiligt haben und die Mehrheit der WählerInnen ihre Zustimmung gegeben hat, ist der Gemeinderat verpflichtet, innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Bekanntgabe des Ergebnisses Stellung zu nehmen und zu erklären, ob er sich daran halten oder davon abweichen wird.“ (Satzung Bozen, Art. 59)
Somit ja zur direkten Demokratie, nein zu satzungswidrig interpretierten, beliebig durchgezogenen Plebisziten von oben. Diese Bedenken gelten unabhängig vom heutigen Ausgang der Befragung. Ende 2014 habe ich selbst eine echte Volksabstimmung über das Benko-Projekt gefordert, nach Änderung der Satzung. Im Februar 2016 habe ich auf SALTO die 5 Schritte genannt, die für eine korrekte Abwicklung nötig wären. Die Befragung á la Penta bleibt anfechtbar, die Frage der politischen Legitimation dieses Projekts ist nicht vom Tisch. Der neue Gemeinderat muss daraus rasch die Konsequenz ziehen und die Bürgerbeteiligung neu regeln.
(SALTO am 5.4.2016)
Grandi magazzini Benko
La legittimazione democratica rimane discutibileIl caporedattore della RAI W. Mayr ha definito i critici del referendum sul progetto Benko "becchini della partecipazione diretta dei cittadini" questa mattina. L'ormai prevedibile risultato del sondaggio - circa due terzi per Benko - ha confermato i punti critici.
I rappresentanti dei media, ad esempio, parlano costantemente di una "affluenza alle urne" che, a quanto pare, ammontava al 36%. Ma in base a cosa? Pendolari provenienti da tutto il paese avrebbero potuto e molto probabilmente vi hanno partecipato. Queste persone sono state in grado di definire da sole in cosa consiste il loro pendolarismo, quindi la popolazione degli aventi diritto al voto è sconosciuta, almeno fino a quando le risposte dei cittadini di Bolzano e non di Bolzano non sono determinate separatamente. In breve: non c'è alcuna "affluenza" in questo puro sondaggio.
I cittadini di Bolzano, che erano veramente responsabili di questa questione, avevano buoni motivi per essere scettici. Il Commissario Penta vuole continuare l'intero progetto sulla base di una maggioranza SÌ di un'indagine pura. Se avesse detto di no, avrebbe passato tutto al nuovo consiglio comunale. Ma un interrogatorio non è lo stesso di un referendum vincolante o di un referendum consultivo (art. 59 dello Statuto di Bolzano) con regole corrette.
Naturalmente, l'elaborata campagna degli operatori di progetto è essenziale anche per il risultato di Pro Benko. Ora non può essere evitato anche con una buona regolamentazione della democrazia diretta che le federazioni finanziariamente forti e gli individui solvibili con la loro opinione sul denaro fanno funzionare. Per il settore pubblico, sia esso locale, statale o statale, oltre all'apertura dei media a tutti gli oppositori, è quindi ancora più importante che i suoi obblighi di informazione siano regolati in modo equo. Tuttavia, il Commissario Penta non ha seguito esattamente questo, anche se tutti i comuni della regione (Gemeindeordnung, R.G. vom 9.12.2014, Nr.11) sono obbligati ad inviare tali opuscoli a tutti gli elettori. Penta sosterrà che si trattava solo di un'indagine sulla popolazione, per la quale questa disposizione non si applica. D'altra parte, vuole considerare il risultato come vincolante o politicamente legittimante per l'approvazione del progetto. Incoerente e dubbia.
Un altro punto: i cittadini di Bolzano vogliono chiedere un vero e proprio referendum sul progetto Benko tra gli aventi diritto di voto a Bolzano - non funzionerebbe! La costituzione comunale, art. 59, P.5, non consente alcun tema urbanisticamente rilevante per un referendum. E l'art. 59, P.11, prescrive persino il quorum per un referendum consultivo:
"11. se almeno il 40% più un elettore ha partecipato ad un referendum consultivo e la maggioranza degli elettori ha dato il loro consenso, il consiglio comunale è tenuto a prendere posizione entro 30 (trenta) giorni dall'annuncio del risultato e a dichiarare se vi si atterrà o meno". (Statuto di Bolzano, art. 59)
Quindi, sì alla democrazia diretta, no ai plebisciti dall'alto che vengono interpretati in contrasto con la costituzione e che vengono arbitrariamente fatti passare. Queste preoccupazioni si applicano indipendentemente dall'esito attuale dell'indagine. Alla fine del 2014, io stesso ho chiesto un vero e proprio referendum sul progetto Benko, dopo che lo statuto era stato modificato. Nel febbraio 2016, ho elencato su SALTO le 5 fasi che sarebbero state necessarie per una corretta attuazione. L'interrogazione á la Penta rimane contestabile, la questione della legittimità politica di questo progetto non è fuori discussione. Il nuovo consiglio comunale deve trarre rapidamente le necessarie conclusioni e regolamentare nuovamente la partecipazione dei cittadini.
(SALTO, 10.4.2016)
Großprojekt
Benko-Kaufhaus vors VolkDie Bozner Bürger haben es durchaus in der Hand, Benkos „trojanisches Pferd“ noch ganz demokratisch abzuwehren: per Volksabstimmung.
Eine für Bozens Zukunft so weitreichende Entscheidung wie die Verbauung des von Benko anvisierten Innenstadtareals mit Magneteffekt für neuen Verkehr kann eigentlich nur von der Bevölkerung selbst entschieden werden. In den Debatten der letzten Wochen haben Stadtplaner, Expertinnen, Architekten und besorgte Bürgerinnen eine solche Fülle von Einwänden gegen das Benko-Vorhaben vorgebracht, dass der Gemeinderat von sich aus dieses Projekt der Bürgerschaft vorlegen müsste. Seine Auswirkungen auf die Luftqualität, auf Handelsstruktur und Arbeitsplätze im Handel in ganz Bozen und Umgebung, auf die Folgekosten der Gemeinde können am besten im Rahmen eines Volksentscheids thematisiert werden. Man kann sich nur wundern, wie viele zentrale Aspekte die Dienststellenkonferenz unberücksichtigt gelassen hat, indem nur zwei fragwürdige Projekte begutachtet worden sind.
Somit sollten Bozens Bürger nach einem Beschluss des Gemeinderats ihr Recht auf abrogatives Referendum (Art. 59 Satzung Bozen) mit 4.000 Unterschriften einfordern. Alternativ dazu kann auch der Gemeinderat mit 2/3-Mehrheit von sich aus eine solche Volksabstimmung veranlassen. Außerdem gibt die Bozner Satzung (Art.50) dem Gemeinderat die Möglichkeit, eine nicht-bindende Volksbefragung zu organisieren. In diesem Fall müssten sich Rat und Ausschuss aber politisch dazu verpflichten, das Ergebnis einer solchen Befragung zu respektieren.
Allein schon die Auswirkungen und Größenordnung dieses Bauvorhabens von über 200 Mio. Euro wären in anderen Städten und Regionen Grund genug, die Bürgerschaft entscheiden zu lassen. So sieht Zürichs Verfassung von 2005 (Art. 33, Punkt d), vor, dass "dem Volk werden auf Verlangen zur Abstimmung unterbreitet: 1. neue einmalige Ausgaben von mehr als 6 Mio. Franken; 2. neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 600.000 Franken". In der Toskana muss bei Projekten im Umfang von über 50 Mio. Euro gemäß Regionalgesetz verpflichtend das Beteiligungsverfahren der „Öffentlichen Debatte“ angewandt werden.
Allerdings muss sowohl eine solche Volksabstimmung als auch das Projekt selbst zu einem zentralen Thema des Wahlkampfs werden. Die Bozner Wähler haben den Anspruch, mit ihrer Stimme diese gewichtige Entscheidung zu beeinflussen. Das kann nur erfolgen, wenn sich die BM-Kandidaten dazu klar positionieren, aber nicht im letzten Monat ihrer Amtsperiode eine umstrittene Entscheidung durchpeitschen. Die Volksabstimmung über das Benko-Projekt sollte zudem nach neuen besseren Regeln erfolgen. Alle neu gewählten Gemeinderäte werden 2015 ihre Satzungen an die neue Gemeindeordnung (Reg.ges. 9.12.2014, Nr.11) anpassen. So muss Bozen z.B. das Beteiligungsquorum von 40 auf 25% senken. Eine Entscheidung für oder gegen dieses Projekt sollte zudem nicht unter der Beregnung der Benko-Propaganda, sondern bei korrekter und fairer Information der Gemeinde selbst wie der Medien erfolgen. Außerdem muss der Gemeinderat den Art. 59, 5b streichen, der „Maßnahmen, die sich auf die Bauleitpläne, auf die entsprechenden Durchführungspläne und deren Änderungen auswirken“ von Volksabstimmungen ausschließt.
Wenn man Bürgerbeteiligung ernst nimmt, ist der Ablauf eigentlich klar: Benko-Projekt-Genehmigung aufschieben, Projekt und Volksabstimmung dazu zum Wahlkampfthema machen (was ohnehin geschieht), Gemeindewahl, Anpassung der Regelung der Volksabstimmung vornehmen, dann kann der Gemeinderat eine Volksbefragung einleiten oder der Gemeinderat kann zum Kaufhaus entscheiden und die Bürger eine Volksabstimmung einleiten (Herbst 2015). (Erschienen auf SALTO am 13.3.2015)
Wahl-Zumutung
Renzi bestimmt SVP-Vertreter in RomKurios, aber eigentlich folgerichtig, dass sich PD-Chef Matteo Renzi für seine Vertraute M.E. Boschi den Wahlkreis Bozen-Unterland aussucht. Zum einen glaubt Renzi, dass auf die Südtiroler – montanari fedeli - Verlass ist: die wählen auch eine in ihrer Heimatregion nicht mehr präsentable Kandidatin. Zum andern hat Südtirol als einiges Gebiet neben der Toskana für die zentralistische Verfassungsreform gestimmt, für die genau diese ex-Staatssekretärin beim Ministerratspräsidium steht.
Boschi wird in Südtirol und in den anderen Regionen angekreidet, dass sie sich 2014 zur Aussage verstieg, alle Regionen mit Sonderstatut abschaffen zu wollen. Im jetzigen Wahlkampf wird sie dies x-mal dementieren, doch weit entscheidender ist: wäre ihre Verfassungsreform 2016 durchgegangen, wären die Normalregionen stark zurückgestutzt und der Zentralstaat wesentlich gestärkt worden. Boschi hat die Suprematie-Klausel erfunden: um auf dem gesamten Staatsgebiet rechtliche und wirtschaftliche Einheitlichkeit zu garantieren, hätte der Staat jederzeit in die primären Zuständigkeiten der Regionen eingreifen können. Ein Einmischungsinstrument für Rom, das über kurz oder lang auch für Südtirol zum Problem geworden wäre. Auch die geringe Finanzautonomie der Regionen wollte Boschi beschneiden. Wogegen sie nichts einzuwenden hatte, war die Bankenrettung durch den Staat (einschließlich der Bank ihres Vaters), die Italien 2015-2017 mindestens 30 Milliarden Euro gekostet hat.
Diese Person wird jetzt den SVP-Wählern in Bozen-Unterland zum Wählen vorgesetzt. Bozen hat, als einzige Ausnahme in Südtirol, die Verfassungsreform Renzi-Boschi am 4.12.2016 knapp abgelehnt. In Bozen allein würde Boschi den Sprung ins Parlament gar nicht schaffen. Entscheidend sind also die Stimmen der SVP-Wähler im Unterland. Eine klare Zentralstaatsverfechterin wird somit dank SVP Nachfolgerin von Peterlini und Palermo. Welche eine erstaunliche Wendung einer Autonomie-Partei.
Damit offenbart sich von neuem ein politisches Geschäftsmodell, das man eigentlich nur mehr klientelistisch nennen kann. Die SVP paktiert seit 25 Jahren mit dem PD, der unter der italienischsprachigen Wählerschaft in Südtirol nicht mehr die 30% erreicht. Die Südtiroler PD für sich wäre in Rom nicht mehr vertreten und hat diesen Anspruch mit dem Verzicht eines einheimischen Kandidaten auch schon aufgegeben. Sie bedient jetzt Renzi mit dem Wahlkreis Bozen-Unterland als „ufficio di collocamento di candidati impresentabili“ (M5S). Das Geschäftsmodell ist erfolgreich, weil dieser Pakt immer wieder kleine Erfolge in Rom einbringt. So hat sich der PD die Zustimmung der SVP zur Verfassungsreform mit eine fragwürdigen Schutzklausel geholt, die in den anderen autonomen Regionen nicht überzeugt hat. Klientelistisch ist das Verhältnis, weil nicht mehr klare Programme den Ausschlag geben, sondern das wechselseitige Interesse, die richtigen Leute auf bestimmte Posten zu hieven. Boschi soll jetzt eine Art Fürsprecherin der Südtirol-Autonomie in Rom werden, also statt klaren inhaltlichen Abmachungen nur mehr Vitamin B?
Überdies kann sich der PD nicht mehr anmaßen, die einzige oder wichtigste Partei Italiens zu sein, die für mehr Rechte der Regionen und Autonomie einsteht. Und Renzi ist nach der gescheiterten Verfassungsreform nicht recht glaubwürdig als Premier, der den Regionalismus fördern wird. Liegt es noch im Interesse der Südtirol-Autonomie, wenn die SVP für Renzis Architektin dieser Reform den Steigbügel hält? Wenn Boschi bei ihrer Linie bleibt, wählen die SVP-Wähler in Bozen-Unterland eine Frau, die für mehr Zentralismus eintritt. Wieviel lassen sich SVP-Wähler zumuten?
SALTO, Februar 2018
Doppelstaatsbürgerschaft
Doppelte Staatsbürgerschaft oder Regionalbürgerschaft?Der Brief der 19 Landtagsabgeordneten zum „Doppelpass“ hat die SVP wieder in Zugzwang versetzt. Die SVP will sich zwar nichts „auf undiplomatische Art“ von außen zurufen lassen, nicht einmal von der Mehrheit des Landtags, immerhin das einzige direkt gewählten Organ auf Landesebene. Dennoch sieht sich der SVP-Obmann gedrängt, auf den Zug aufzuspringen, allerdings – so präzisierte Philipp Achammer in der RAI-Tagesschau – im europäischen Geist.
Entspricht eine Doppelstaatsbürgerschaft tatsächlich dem europäischen Geist? Eher nicht, denn in der EU ist man schon längst übereingekommen, von Mehrfachstaatsbürgerschaften abzugehen und die Unionsbürgerschaft zu betonen. EU-Bürgerinnen sollen in der ganzen EU gleichberechtigt sein, sie wählen auch schon bei Kommunalwahlen im jeweiligen Wohnsitzland, was durchaus auch aufs Regionalwahlrecht ausgedehnt werden könnte. Wo man lebt, arbeitet und Steuern zahlt, soll man auch die Politik mitbestimmen können. Dieser einfache Grundsatz entspricht nicht nur den EU-Verträgen, sondern auch der Demokratie. Geht Österreich davon ab, müsste es für Südtirol eine Ausnahme schaffen und gerät in die Verlegenheit, bei Gewährung seiner Staatsbürgerschaft das EU-Diskriminierungsverbot nicht zu verletzen.
Andererseits gewährt Italien die Doppelstaatsbürgerschaft nicht nur gut 4,8 Millionen Auslandsitalienern, sondern auch den Angehörigen einiger italienischer autochthoner Minderheiten (z.B. in Istrien). Machen solche Doppelstaatsbürgerschaften für ein demokratisches Gemeinwesen Sinn? Einerseits können nun die Auslandsitaliener, auch wenn sie nie mehr zurückkommen, über die Wahl des Parlaments die italienische Politik mitbestimmen (z.B. auch das Südtiroler Autonomiestatut), und gut eine Million nutzt dieses Recht regelmäßig. Andererseits haben über 5 Millionen legal in Italien ansässige Ausländer nicht das geringste Wahlrecht, auch wenn sie 30 Jahre im Land leben. Im Unterschied zu den seit 1861 ausgewanderten Italienern und ihren Nachfahren waren überdies die Südtiroler nie Bürger des Staats Österreich.
So bietet sich die paradoxe Situation, dass z.B. ein „Südtiroler Kosovare“, der hier integriert oder gar schon in zweiter Generation lebt, kein politisches Mitspracherecht genießt, während ein Urenkel von nach Argentinien ausgewanderten Italienern die italienische Politik (auch unser Autonomiestatut) mitbestimmt. Dieses Argument gilt auch für die künftigen Südtiroler mit österreichischer Staatsbürgerschaft: warum sollte man in Wien die Steuer-, Finanz- und Rentenpolitik mitbestimmen, ohne in Bozen von jenem Steuer-, Finanz- und Rentenrecht irgendwie betroffen zu sein?
Auch für Südtiroler patriotische Kräfte und insbesondere die Freiheitlichen, die ein unabhängiges Südtirol zu ihrem Leitbild erkoren haben, macht die österreichische Staatsbürgerschaft keinen rechten Sinn. Entweder man will sich Österreich angliedern und betrachtet den Erwerb der Staatsbürgerschaft als einen Schritt dahin. Zuerst das Volk sozusagen, dann das Territorium. Ein unabhängiger Staat hat aber seine eigene Staatsbürgerschaft, und die gilt für alle Südtiroler gleich welcher Sprache, wie die Freiheitlichen betonen. Doch warum sollte man die Südtiroler zur Annahme der österreichischen Staatsbürgerschaft bewegen, wenn man später in einem eigenen Staat Südtirol leben will?
Die Alternative im europäischen, eher noch im autonomistischen Geist wäre eine Regionalbürgerschaft, wie sie die Aland-Inseln in Finnland eingerichtet haben. Wer auf Aland ausreichend Schwedisch spricht und mindestens 5 Jahre ansässig war, kann dieses „Hembygdsrätt“ (Heimatrecht) erwerben und damit die Gewerbefreiheit, das Recht auf Grunderwerb sowie das lokale Wahlrecht. Dies in Übereinstimmung mit Unionsrecht wohlgemerkt. Um echt europäisch zu sein, könnte diese Regionalbürgerschaft jedoch inklusiver ausgestaltet werden. Wer in Südtirol lebt, also eine Mindestansässigkeit aufweisen kann, die Landessprachen erlernt, hier Steuern zahlt und sich Südtirol verbunden fühlt, soll auch die politischen Rechte genießen und eventuell die Gleichstellung als Bewerber im öffentlichen Dienst erhalten. Das praktizieren auch zahlreiche Schweizer Kantone so, während in Italien allerdings fürs Landtagswahlrecht für Ausländer vorab das staatliche Wahlrecht geändert werden müsste. Eine solche Regionalbürgerschaft würde alle Sprachgruppen gleichermaßen ansprechen, und auch Migranten könnten sich zugehöriger fühlen. Den im Land lebenden Menschen mehr Anreiz zur Integration zu bieten und damit alle besser zu verwurzeln, ist wichtiger als nur einem Teil der Bevölkerung eine ausländische Staatsbürgerschaft anzudienen, um sich als Bürger Österreichs zu fühlen, was man de facto nicht ist.
(Erschienen auf SALTO am 26.11.2017)
50. Todestag von Sepp Kerschbaumer
Der „pazifistischste Freiheitskämpfer“Mit einer Gedenkfeier und der Enthüllung einer Gedenktafel am Dorftreff Schenk hat Frangart heute Sepp Kerschbaumer gedacht, der am 7. Dezember 1964 im Gefängnis in Verona einem Herzinfarkt erlegen ist. Dieses historische Gasthaus war in den 60er Jahren ein Treffpunkt der Mitglieder des Befreiungssauschusses BAS, dessen Kopf Kerschbaumer war. Hier traf man sich für politische Diskussionen und für die Vorbereitungen für die „Feuernacht“ am 12./13. Juni 1961.
Kerschbaumer war nach dem frühen Tod seiner Eltern als Vollwaise in Heim und Kloster aufgewachsen. Weil politisch auffällig war er nach dem Militärdienst von den Faschisten für ein Jahr nach Potenza verbannt worden. Seit Anfang der 1950er Jahre widmete sich Kerschbaumer immer mehr der Politik, agitierte, traf sich mit Politikern - sogar mit Bruno Kreisky in Wien – und trat einmal 23 Tage in den Hungerstreik. „Auch das Verbot der Tiroler Fahne ließ Kerschbaumer keine Ruhe“, führte die Historikerin Margareth Lun aus, die heute in Frangart die Gedenkrede hielt, „er hisste Fahnen auf Hochspannungsmasten und saß fürs Anbringen der Fahne an der Frangarter Kirche 10 Tage im Gefängnis.“
Der politische Widerstand schien dem BAS immer fruchtloser, „der Grund, weshalb der BAS zunächst beschloss, Objekte mit Symbolcharakter zu sprengen. Aber immer mit der strengen Auflage, ja keine Menschenleben zu gefährden. Schließlich ließ sich Kerschbaumer davon überzeugen, dass es einfacher war, zu einem großen Schlag auszuholen. Dass nach der Feuernacht so viele inhaftiert und gefoltert wurden, damit hatte wohl niemand gerechnet,“ so Lun.
Gleich nach der Feuernacht wurde Kerschbaumer verhaftet und in der Eppaner Carabinieri-Kaserne tagelang schwer gefoltert: „Es entspricht seinem Charakter,“ führte die Historikerin aus, „dass er versuchte, so viel Verantwortung auf sich zu nehmen, um seine Mitstreiter zu entlasten. Ende 1963 begann der Mailänder Prozess, der 7 Monate dauerte, über 500 Personen wurden angehört, Staatsanwalt redete sechs Tage lang gegen die Häftlinge.“
Am 16. Juli 1963 erging das Urteil. Sepp Kerschbaumer erhielt fast 16 Jahre Gefängnis. Die vielen Hungerstreiks, die psychische Belastung, all das haben dazu beigetragen, dass Kerschbaumer nur eineinhalb Jahre danach am 7.12.1964 mit 51 Jahren im Gefängnis an Herzinfarkt starb Er hinterließ seine Frau und 6 Kinder, das jüngste war eben 6 Jahre alt. Seine Beerdigung in St. Pauls wurde zu einer Solidaritätskundgebung, an der über 20.000 Menschen teilnahmen.
Sepp Kerschbaumer ist alles andere als vergessen, das alljährliche Gedenken an ihn in St. Pauls ist immer gut besucht. „Sepp Kerschbaumer war ein Mann, dem selbst Richter und italienische Medien Respekt zollten,“ erklärte Margareth Lun heute in Frangart, „kein kühler Analytiker, eher ein Märtyrer und Idealist mit franziskanischer Lebensführung und strengsten moralischen Grundsätzen. Sein Leben lang hat er beispielhaft Zivilcourage gezeigt, um das zu sagen, was ihm unter den Fingern brannte und zu seinem Wort zu stehen. Kerschbaumer getraute sich, zu provozieren, um Themen immer wieder aufs Tapet zu bringen, traute sich, die Finger in die Wunde zu legen, auch wenn es zu seinem persönlichen Nachteil gereichte.“
Dabei unterschied Kerschbaumer streng, wie es hieß, zwischen den Italienern in Alltagsproblemen, denen er half, und dem ital. Staat auf der anderen Seite, der eine Politik ausübte, die für die Tiroler nicht akzeptabel war. Lun: „Beeindruckend sein Gottvertrauen und seine tiefe Religiosität. Verzicht und Opferbereitschaft fielen ihm anscheinend nicht schwer, wenn es darum ging, Ziele für seine Heimat anzustreben. Wenn es uns auch schwer verständlich ist, wie selbstverständlich er seine Familie ihrem Schicksal überließ, ohne sie jemals in seine Entscheidungen miteinzubeziehen, so war dies wohl in seinen Augen seine Pflicht, sein persönliches Opfer für die Zukunft seiner Heimat, seine Verantwortung für die kommenden Generationen.“
Das Schicksal Sepp Kerschbaumers ist Teil der Südtiroler Geschichte. Dieser Mann der Tat verkörpert in gewissem Sinn den militanten Widerstand, den hunderte Südtiroler gegen die staatliche Politik leisten wollten. Kein Wunder, dass sich an ihm die staatliche Repression auslud, doch Kerschbaumer und seine Mitstreiter lösten eine Dynamik aus, die Rom schließlich zur Gewährung der Paket-Autonomie zwang.
„Der zeitliche Abstand zu den 60er Jahren und zum Kampf der BAS dürfte groß genug sein,“ so der Ortsvorsteher von Frangart Günther Roner, „um diese Zeit endgültig der Geschichtsschreibung zu überlassen und als Teil unserer gemeinsamen Geschichte zu betrachten. Als Teil dieses Landes verstehe ich die Angehörigen aller Volksgruppen, die in Südtirol ihre Heimat gefunden haben, oder sie in nächster Zeit finden werden.“
(Erschienen auf SALTO)
„Kulturhauptstadt“ Nordostitalien 2019
Die Erfindung einer KulturregionDas Abkommen zur Bewerbung des Nordosten Italiens als „Kulturhauptstadt 2019“ ist unterzeichnet, das Bewerbungskomitee gegründet, das Führungskomitee und der wissenschaftliche Beirat eingesetzt, dem auch ein Südtiroler angehört. Mit einem eigenen Promotorenkomitee wollen die Südtiroler Kulturlandesräte die Südtiroler Öffentlichkeit auf dieses sonderbare Projekt einstimmen – eine nicht-existente Region als „Kulturhauptstadt“ oder „Kulturregion“ zu vermarkten, und ein „wissenschaftlicher“ Beitrat erhält den Auftrag, sich eine Begründung für diese Marketingoperation auszudenken.
Nichts spricht dagegen, europäische Kulturregionen ins Licht zu rücken. Europa besteht aus fast 300 Kulturregionen. Es wäre nur konsequent, neben die jährlich ausgerufene „europäische Kulturhauptstadt“ frisch einen zweiten Wettbewerb für eine „Kulturregion des Jahres“ zu stellen, anstatt das Konzept zu überdehnen. Was macht aber gerade den geografischen Raum Nordostitalien zu einer „Kulturregion“? Die drei-vier Regionen Trentino, Südtirol, Venetien und Friaul-Julisch Venetien sind doch allesamt für sich Regionen mit ausgeprägter kultureller Identität. Es wird kaum reichen, dass dieses Gebiet von 1815 (erstmals von Österreich 1797 annektiert) bis 1866 gemeinsam Teil des k.u.k-Reichs war. Es wird nicht reichen, dass es unter dem Faschismus zum „Triveneto“ erklärt worden ist, ein Begriff, der immer noch in der italienischen Publizistik herumgeistert. Auch das verschwommene Konzept von Mitteleuropa gibt zu wenig an Gemeinsamkeit her. Dass es in allen Regionen Sprachminderheiten gibt, ist auch nicht das Verbindende, denn sie spielen zumindest in Venetien fast keine Rolle. Fantasievolle Redner werden gefragt sein, um für die entsprechende Aufladung mit Gemeinsamkeiten zu sorgen.
Also riecht das Ganze doch wieder nach geschickt angelegter Strategie zur touristischen Vermarktung, nach Mitnaschen am Förderungskuchen der EU, nach künstlichen Dachmarken und Plattformen für internationale Bewerbung jenseits jedes klaren Profils. Was wirklich Appetit macht ist die Tatsache, dass laut Statistik europäische Kulturhauptstädte im Schnitt ein Plus von 12% an Touristenzustrom verzeichnen konnten. Hunderte von Veranstaltungen, die ohnehin angesetzt und gut besucht würden, liefen dann eben unter dieser artifiziellen Klammer. Doch hat Venedig oder Verona das nötig? Braucht Südtirol mit seinen bald 29 Millionen Nächtigungen das überhaupt? In der Internetwerbung der Venezianer für die Kulturhauptstadt (www.nordest2019.eu) wird Südtirol überdies kurzerhand in die „area metropolitana del Nordest“ einverleibt, eine Art Hinterland Venedigs, dem die Gäste der Hauptattraktion Venedig eine kurze Stippvisite abstatten sollen.
Eine Region der europäischen Öffentlichkeit als „Kulturregion“zu präsentieren und über die EU zu fördern, macht Sinn, wenn sich ihre Bevölkerung einer erkennbar gemeinsamen Identität verbunden weiß. Das Konzept an sich wird ad absurdum geführt, wenn es nur mehr als Instrument der Destinationsbewerbung dient. Kasslatter-Mur hat denn auch gleich klargestellt, dass es bei der Bewerbung darum geht, sich in diesem Rahmen als deutsche und ladinische Sprachminderheit zu präsentieren. In der Kulturregion, der sich die allermeisten Südtiroler zugehörig fühlen, sind die Südtiroler aber keine „Sprachminderheit“. Nicht umsonst strapazieren unsere Kulturpolitiker das mehrsprachige Südtirol als besondere Realität, nicht als Minderheitenregion.
Eine gemeinsame regionale Identität des Nordostens Italiens lässt sich weder erkennen noch aus Marketinggründen herbeireden. Im Gegenteil, die Erfindung einer Kulturregion Nordost lässt eine gewachsene Region in den Schatten treten, die es auch institutionell wieder gibt, die von der EU gefördert wird und darauf wartet, mit mehr Inhalten und Initiativen gefüllt zu werden: die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Warum schafft man also in Europa Verwirrung, indem man Südtirol einmal zu diesem Raum schlägt, einmal zum anderen; einmal sich auch kulturell ganz Italien zurechnet, dann wieder in der 150-Jahre-Einheits-Diskussion ganz den eigenständigen Tiroler gibt? Gefragt, ob das zeitliche Zusammenfallen des angepeilten Kulturregion-Jahres 2019 mit dem 100-Jahren Zugehörigkeit zu Italien ein Problem sei, antwortete Durnwalder: „Im Gegenteil, wir wollen auch im Rahmen der Bewerbung zeigen, dass Südtirol ein ganz besonderes Land mit einer entsprechenden Geschichte und Kultur ist“ (im Südtiroler Bürgernetz). Sich in ein Kunstgebilde einfügen, um sich dann krampfhaft wieder davon distanzieren zu müssen?
Erschienen auf SALTO 2015
Doppelte Staatsbürgerschaft
“Regionsbürgerschaft” statt doppelter StaatsbürgerschaftDie Südtiroler Freiheit drängt wieder einmal auf die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler Hier einige Kritikpunkte und ein Gegenvorschlag.
Politisches Bewusstsein wird weiter auseinanderdividiert
Die Mitgliedschaft in einem Staat (Bürgerschaft) begründet Rechte und Pflichten. Den Südtirolern würde die zusätzliche Bürgerschaft im österreichischen Staat vor allem Rechte wie das Wahlrecht verschaffen und neue Leistungsansprüche begründen, aber weniger Pflichten bewirken: weder hätten wir Steuern nach Wien zu entrichten noch zum Bundesheer einzurücken. Weil wir bei der Nationalratswahl mitwählen könnten, würden sich die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler etwas mehr für die österreichische Politik interessieren, die uns nicht direkt betrifft; entsprechend weiter ab nähme das Interesse für die italienische Politik, die uns direkt betrifft. Laut ASTAT verfolgt schon heute nicht mal ein Zehntel dieser Kreise die italienische Politik näher (vgl. ASTAT, Lebensformen und Werthaltungen in Südtirol, Bozen 2007). Das Land fiele im politischen Bewusstsein und sprachlich getrennten Medienkonsum noch weiter auseinander.
Es gibt schon das Gleichstellungsgesetz
Ohne Zweifel könnte die doppelte Staatsbürgerschaft die Bindung der Minderheiten zum “Mutterland” einerseits und die Verantwortung der Schutzmacht für seine Staatsbürger im Ausland andererseits nochmals stärken. Doch sind die Südtiroler einerseits durch das Gleichstellungsgesetz in Österreich ohnehin schon in vielerlei Hinsicht den Inländern gleichgestellt. Andererseits ist unsere Autonomie völkerrechtlich abgesichert und die Schutzfunktion Österreichs dafür wird von Italien nicht in Frage gestellt. Die eigentliche “Schutzfunktion” hat ja die Autonomie, dies es uns ermöglicht, im eigenen Land gleichberechtigt und eigenständig zu leben. Sie hat auch den Sinn, dass alle offiziellen Sprachgruppen die Politik gleichberechtigt und möglichst eigenständig gestalten und nicht mit halben Fuß im jeweiligen “Ausland” leben. Mit der Erfüllung neuer Leistungsansprüche von nicht Steuer zahlenden Staatsbürgern im Ausland wird man sich auch in Wien schwer tun, weil man auch dort weiß, dass Südtirol kein armes Land mehr ist.
EU-Bürgerschaft wichtiger
In Südtirol würde die doppelte Staatsbürgerschaft die bestehende Ausdifferenzierung von Bürgern mit verschiedener Rechtslage erweitern: die Angehörigen der altösterreichischen Minderheiten, die “normalen” Staatsbürger, die EU-Bürger, die ausländischen Mitbürger mit Daueraufenthaltsrecht, jene mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung. Für die schon recht gut geschützten Bürger würde ein neuen Schutzschirm aufgespannt, während für die “emotionale Einbürgerung” der italienischen Mitbürger und die Integration der neuen Zuwanderer mit einer solchen Neuerung nicht geholfen wäre. Ein weiterer Schutzschirm ist auch deshalb wenig dringlich, weil Europa allgemein einen Rechtsrahmen für den Minderheitenschutz aufgebaut hat, die Rahmenkonvention für Nationale Minderheiten, die Italien und Österreich ratifiziert haben. In der EU ist man von Doppelstaatsbürgerschaften abgekommen, weil man zum einen Nicht-EU-Migranten zu einer Entscheidung bezüglich ihres Lebensmittelpunkts bewegen will, und zum andern die EU-Bürgerschaft allen EU-Bürgern ohnehin eine breite Palette von Rechten und Möglichkeiten eröffnet.
Mehr Bindung zum Land für alle
Nicht zusätzlicher Schutz durch Angehörigkeit zu einem anderen Staat ist vordringlich, sondern mehr gemeinschaftliche Bindung zum eigenen Land aller Gruppen. Gerade die alte Migration (Italiener, die vor 2-3 Generationen zugewandert sind), und die Migration der letzten 25 Jahre werfen ein Problem dieser Art von Bürgerschaft auf. Viele Italiener sind noch immer nicht ausreichend in Südtirol verwurzelt, sprechen wenig Deutsch, misstrauen der deutschen Mehrheitsbevölkerung wie die letzte Volksabstimmung deutlich gezeigt hat, klammern sich an faschistische Relikte und Ortsnamen, als ob diese Identität begründen könnte. Sie betrachten die Staatsbürgerschaft als entscheidend, nicht die Regionsbürgerschaft. Für die neuen Einwanderer ist der Weg zur Integration in ein Land wie unseres anstrengend: der italienische Staat erschwert die Einbürgerung und in Südtirol müssen sie und ihre Kinder gleich zwei neue Sprachen lernen. Dabei wirft schon eine fremde Sprache ein Problem auf: die vielen halbsprachigen Migrantenkinder in den Ländern mit älterer Migration, die im Bildungssystem und Arbeitsmarkt ganz unten landen, zeugen davon. Andererseits haben die Zuwanderung und die politischen Reaktionen darauf auch einen Mangel in der Autonomie aufgezeigt: Südtirol kann die Zuwanderung nicht autonom steuern.
Vorbild Åland-Inseln
Eine solche Möglichkeit hat hingegen eine andere autonome Region Europas. Auf den Åland-Inseln gibt es das Hembygdsrätt, eine Art Heimatrecht, als Rechtsinstitut. Es wird jenen finnischen Staatsbürgern zuerkannt, die ausreichend Schwedisch sprechen und eine Mindestansässigkeitsdauer vorweisen können. Dieses “Heimatrecht” eröffnet ihnen die Möglichkeit, auf Åland ein Gewerbe auszuüben, Grund zu erwerben und das passive und aktive Wahlrecht auszuüben. Eine solche Regionsbürgerschaft mag für diese fast nur schwedischsprachigen Inseln Finnlands Sinn machen, für Südtirol nicht, obwohl sie absolut EU-konform ist. Doch der Grundgedanke ist wichtig: es geht darum die Bindung der Menschen zu ihrer Region und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken; darum, die Migrationsbewegungen zu stabilisieren und bessere Bedingungen für die Integration zu schaffen; darum, gemeinsame Verantwortung für die engere Heimatregion aufzubauen. Eine solche Regionsbürgerschaft kann allen offen stehen, In- und Ausländern, alten und neuen Zuwanderern. Sie knüpft an denselben Kriterien an, die für den Erwerb der Staatsbürgerschaft, aber auch für den Bezug einiger öffentlichen Leistungen in Südtirol gelten: die legale Ansässigkeitsdauer. Dazu gesellen sich der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, in diesem Land zu leben. Eine derartige Regionsbürgerschaft darf nicht bloß symbolische Wirkung, sondern muss auch konkrete Rechtswirkungen und dadurch einen praktischen Nutzen haben. Sie kann Nicht-Staatsbürgern den Zugang zu Teilbereichen des öffentlichen Dienstes, zu Sozialleistungen (Wohnbau usw.) und zum Wahlrecht auf Gemeinde- und Landesebene öffnen. Sie stabilisiert die Migration und ermutigt Zuwandererfamilien, eine langfristige Perspektive in der Region aufzubauen. Nicht die formale Staatsbürgerschaft, die später folgen kann, sondern Kriterien persönlicher Leistung (Spracherwerb und Sprachnachweis) und das objektive Kriterium der Ansässigkeitsdauer wären maßgeblich. In einem Satz: statt mit doppelter Staatsbürgerschaft noch einen weiteren Schutzschirm für schon Geschützte einzuführen, kann mit einer Regionsbürgerschaft beides befördert werden: mehr Einfluss auf die Migration durch die Landespolitik auszuüben und eine bessere Integration jener Mitbürger zu fördern, die in Südtirol den geringsten Schutz genießen.
Regionsbürgerschaft die Alternative
2016 werden an die 50.000 ausländische Mitbürger und Mitbürgerinnen in Südtirol leben, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und für sich und ihre Kinder eine Zukunftsperspektive aufbauen wollen. Südtirol braucht keine fluktuierende Manövriermasse von Migranten, die kommen und gehen, die keinen Bezug zu unserem Land finden, sondern Menschen, die sich in dieses Land bis zu einem bestimmten Grad “einbürgern” wollen. Somit ist, neben der Staatsbürgerschaft, eine neue Form von Regionsbürgerschaft gefragt, die allen offen steht, die hier arbeiten und auf Dauer leben wollen. Nicht unbedingt die Begründung zusätzlicher Rechte und Ansprüche im Ausland – das ist und bleibt Österreich rechtlich gesehen - schon geschützter Angehörigen einer ethnischen Minderheit ist nötig, sondern mehr Beheimatung für jene, die das Leben zur Auswanderung gezwungen hat und die in Südtirol eine zweite Heimat gefunden haben.
Erschienen auf SALTO 2017
Dokumentationszentrum
Siegesdenkmal: gelungene HistorisierungIn der Krypta thront die „Wächterin des Vaterlands“ gegenüber der „Wächterin der Geschichte“, da fehlte im Freskenzyklus die „Wächterin der Wahrheit“. Wenn nicht die „geschichtliche Wahrheit“ schlechthin, dann birgt das neue Dokumentationszentrum unterm Siegesdenkmal mit Sicherheit eine ziemlich objektive, nüchterne Darstellung der Geschichte des Monuments selbst, Bozens und zum Teil Südtirols zwischen 1918 und 1945.
Damit ist dieser Bau historisiert, also aus seinem geschichtlichen Kontext heraus erklärt und von der offiziellen Anerkennung seiner ursprünglichen Intention gelöst. Es wird für eine distanzierte Beurteilung zugänglich. Vor allem auch für Besucher von außen wird das Monument in seiner ursprünglichen Bedeutungsgehalt und seinem späteren Rolle in der Geschichte der Stadt verständlich, es ist in gewissem Sinn zum Mahnmal geworden. Auch Betrachtungen zur Funktion von Monumenten allgemein fehlen nicht. Äußerlich hätte dies allerdings noch etwas deutlicher werden können als mit einer kleinen Leuchtschrift.
Historisieren bedeutet auch, bewusst zu machen, auf welchem Hintergrund und mit welcher Absicht welche Bedeutung einem solchen Bau beigemessen wird. Wie die Autoren schreiben, hat Piacentini das Monument als einen neuartigen, echten faschistischen Kult-Tempel konzipiert, wie er ihn bis dahin noch nicht gebaut hatte. Das Doku-Zentrum klärt jeden Aspekt sehr präzise. Seinem Stellenwert als offizielles staatliches Denkmal ist das Siegesdenkmal damit entkleidet. Jetzt ist es nur mehr schwer vorstellbar, dass an diesem Monument noch offizielle Militaristenaufmärsche und Kranzniederlegungen abgeführt werden.
Ein längst überfälliger Schritt, der eigentlich gleich nach dem 2. Weltkrieg hätte erfolgen sollen. In jener Phase dachte man nicht im Geringsten an Dekonstruktion oder Historisierung, im Gegenteil: Piffraders Mussolini-Fries am Gerichtsplatz wurde nachträglich eifrig fertiggestellt. Man kann nicht nur den Autoren des Dokumentationszentrums gratulieren, sondern auch der Gemeinde Bozen, die endlich die Kraft gefunden hat, diesen Eingriff zu tun. Immerhin haben erst vor 12 Jahren noch zwei Drittel der Bozner für die Beibehaltung des Platznamens gestimmt.
Das neue Dokumentationszentrum ist auch ein kleines Zeitgeschichtemuseum, das es in Südtirol auf Grundlage einer gemeinsamen Geschichtsschreibung noch nicht gibt. Vielleicht gelingt es nächstens, ein systematisch angelegtes Museum dieser Art im Finanzamt (ehemalige Casa del Fascio) unterzubringen, bei gleichzeitiger Musealisierung des Piffrader-Frieses auf der Fassade.
PS: Zu Recht hat Margareth Lun kritisiert, dass in den englischen Texttafeln immer nur der Begriff „Bolzano“ und „Alto Adige“ verwendet wird, obwohl sogar die meisten englischsprachigen Publikationen des Landes die Bezeichnung „South Tyrol“ verwenden.
(SALTO am 25.7.2014)
Toponomastica
Il compromesso silurato da BizzoSarebbe stata la volta buona per risolvere la questione spinosa, forse una volta per sempre. Palermo con la sua pazienza di scienziato aveva faticosamente preparato il terreno, Zeller e la SVP non potevano fare di più per scendere a patti. Il compromesso elaborato dalla Commissione dei 6 sembrava l’ultimo tentativo di uscire dall’impasse, in cui il governo aveva cacciato le parti in causa impugnando la legge provinciale sulla toponomastica del 25.9.2012, già allora un compromesso sofferto tra PD e SVP.
Per ricordare: quella legge, finita poi davanti alla Consulta senza sentenza definitiva, delegava la competenza per la toponomastica locale ai comprensori. Il consiglio direttivo dei comprensori avrebbe potuto presentare alla nuova Commissione provinciale di cartografia le proposte per i toponimi. Questa commissione avrebbe dovuto valutare le proposte ed eventualmente approvarle. Con quella legge si sarebbe riusciti ad introdurre una nuova procedura consensuale, escludendo a monte un gran numero di toponimi tolomeiani (per esempio tutte le frazioni) che sarebbero comunque rimasti bilingui per legge. La nuova norma di attuazione, ora bocciata, sarebbe stata ancora più consensuale, perché due membri di lingua italiana su sei in tutto avrebbero avuto il diritto di bloccare ogni tentativo di togliere qualche malcapitata invenzione di Tolomei. In altre parole: Se non ci fosse stato il consenso di 5 su 6 membri ogni toponimo di origine fascista sarebbe rimasto intatto.
E adesso Bizzo, che assale il suo partito alle spalle. Sembra essere preda di questa brutta logica che all’interno del gruppo italiano si è diffusa in tutti i gruppi politici. Evidentemente si pensa che sia eleggibile, che si guadagni la fiducia dell’elettorato solo chi difende fino in fondo tutto il lascito tolomeiano. Tutti gli 8.350 nomi del Prontuario da trarre in salvo: è questo che voleva Bizzo. Poi solo una parte dei micro-toponimi comunque non utilizzati sarebbe stata eventualmente “sacrificata” con la soluzione individuata dalla Commissione dei 6.
Peccato che ci sia così poco coraggio civile fra i politici altoatesini del centro-sinistra. Anzi, sembra che un altoatesino di lingua italiana che valuta il Prontuario di Tolomei partendo da una lettura critica del fascismo venisse immediatamente tacciato di essere un traditore. Sono ancora pochi gli altoatesini che si sono liberati di questa logica nefasta.
A parte il fatto che da una prospettiva del gruppo di lingua tedesca questo compromesso era molto spinto, seppellendo questa norma di attuazione la toponomastica resterà una spina nel fianco della convivenza rispettosa della cultura e della storia della terra in cui si convive. Anzi, la toponomastica eternamente rinviata resterà un fattore di disturbo (Störfaktor) di una convivenza dei gruppi fattasi reciprocamente più rispettosa degli ultimi anni. Si potrà vivere con questa situazione per altri 70 anni, afferma giustamente Palermo, come l’abbiamo fatto dal 1945. Ma resta un grande equivoco: arroccarsi attorno ai nomi di impronta fascista, in gran parte neanche utilizzati, significa non aver studiato a fondo la storia di questa terra da una prospettiva democratica, comprendendo i motivi di chi in quei posti fra “Salonetto” e “Spelonca” ha sempre vissuto. Mettere radici significa avvicinarsi alla gente del posto con la loro storia, non ai simboli piantati da un unico sciovinista un secolo fa
(SALTO am 9.3.2017)
Neuer Anlauf im Senat
Die Reform des Autonomiestatuts konkretIm Corriere dell‘ALTO ADIGE ist die Rede von einer „via catalana“ und Urzì tobt sich im ALTO ADIGE gegen diesen Vorstoß zur „inneren Sezession“ aus. Anscheinend hat er nicht mitbekommen, dass der Verfassungsgesetzentwurf (VerfGE) Nr.43/2018 zur Vollautonomie, in fast identischer Fassung schon am 15.3.2013 von den damaligen Senatoren Zeller und Berger im Senat vorgelegt worden ist. Im Vergleich zum VerfGE Nr. 32/2013 bringt der jetzt von Unterberger, Steger und Durnwalder gezeichnete VerfGE Nr. 43/2018 kaum Neuerungen. Dieser Verfassungsgesetzentwurf hat den Zweck, den jetzigen Stillstand und die Krise der Autonomien zu überwinden, indem die Autonomie der Provinzen Bozen und Trient vervollständigt wird. Hätte diese Frage Priorität in Rom, könnte Südtirol und das Trentino schon 2019 ein neues, drittes Autonomiestatut haben.
Es geht darum – so die Autoren in der ausführlichen Begründung des Vorschlags – die Beziehungen zwischen dem Staat und den Autonomien auf eine völlig neue Grundlage zu stellen (ricostruire, S.4). Die Vollautonomie wird so definiert, dass nur mehr die Geld-, Außen- und Verteidigungspolitik beim Staat verbleiben sollen, während der Rest an die beiden Provinzen geht. Die Palette der Staatszuständigkeiten ist dann tatsächlich breiter, was erst später präzisiert wird, doch einen wesentlichen Sprung würde der Kompetenzenumfang der Provinzen auf jeden Fall machen. Der Gesetzentwurf soll das heutige Statut auch von einer Menge von Bestimmungen und Ausdrücken bereinigen, die längst überholt sind.
Allerdings geht es beim Grad der Autonomie vor allem auch um die Qualität der Zuständigkeit: Das nationale Interesse als Schranke für die autonome Gesetzgebung gilt schon seit 2001 nicht mehr, doch die 2001 eingeführten „transversalen Materien“ des Staats sind für die autonomen Regionen ebenso penetrant und müssten weg. Dies sollte im Art. 2 des neuen VerfGE oder am besten in der Verfassung selbst festgeschrieben werden.
Die Region würde zu einem bloßen „Organ der Konsultation, Planung und Koordination“ der beiden Provinzen, eine Institution ohne Gesetzgebungszuständigkeiten. Hier einige weitere Neuerungen, die die SVP-Senatoren mit ihrer Statutsreform vorschlagen:
• Statutarisch festgeschrieben würden die Zuständigkeiten des Landes, Konzessionen für die Wasserkraft zu vergeben. Außerdem wird der erfolgten Liberalisierung auf dem Strommarkt Rechnung getragen (Art. 12 und 13).
• Die Delegierung von Zuständigkeiten vom Staat ans Land kann mit DFB geschehen (also mit Dekret der Regierung). Auch die Länder können an die Region Zuständigkeiten delegieren, und zwar sowohl legislative wie administrative (Art. 17 und 18).
• Rationalisiert wird der Art. 19, allerdings das Prinzip der muttersprachlichen Schulen voll beibehalten. Das Bildungswesen soll insgesamt als primäre Kompetenz an die Länder gehen (war von Zeller und Berger 2013 vergessen worden).
• Die Region würde künftig von den beiden Provinzen finanziert und hätte keine eigenen Einnahmen mehr (Art.33).
• Die Einnahmen der Länder werden neu geregelt: die Länder treten dem Staat die zustehenden Anteil der Steuereinnahmen ab (Art. 75), nicht umgekehrt.
• Endlich würde den Ländern die primäre Zuständigkeit für die Gemeindefinanzen zuerkannt (Art. 38).
• Auch für die Ladiner wird das Verfahren zur Haushalts-Garantie im Landtag eingeführt, in dem eine entsprechende Landtagskommission ein Vetorecht ausüben könnte (Art. 42).
• Der Regierungskommissar, schon seit 2001 von der Verfassung nicht mehr zwingend vorgesehen, würde aus dem Autonomiestatut für die Provinzen Bozen und Trient gestrichen. Seine Zuständigkeit gehen auf den Landeshauptmann über, wie es schon in der Region Aostatal der Fall ist (Art. 42 und 43).
• Im Verwaltungsgericht Bozen würde künftig auch ein Ladiner als Richter sitzen (Art. 44).
Karl Zeller hat Anfang 2016 angenommen, dass sein Verfassungsgesetzentwurf zur Vollautonomie nach Verabschiedung der Renzi-Boschi-Reform im Parlament behandelt werde. Es kam nicht mehr dazu, weil die Regierung andere Prioritäten hatte. Es gehört zu den Gepflogenheiten im Parlament, möglichst gleich zu Beginn der Legislatur wichtige Gesetzentwürfe im Parlament zu deponieren, weil es allein schon aus Zeitgründen bei weitem nicht alle zur Behandlung schaffen. Aus demokratisch-partizipativer Perspektive könnte man einwenden, dass nach Abwicklung des Konvents 2016-17 jetzt der Landtag und dann der Regionalrat mit ihren Entwürfen dran wären. Doch vielleicht gilt die Devise: lieber die Wiese gleich mähen, als hinterher nur einige Blümchen pflücken.
Ein Prüfstein für die Haltung der Regierungsmehrheit ist dieser VerfGE allemal, und zwar nicht nur für Lega und M5S, sondern auch für den SVP-Bündnispartner PD. Die vor allem von SVP-Wählern ins Parlament gehievte SVP-PD-Abgeordnete Boschi kann beweisen, ob sie zur „Autonomistin“ konvertiert ist. Erheblicher Widerstand ist aus dem Trentino zu erwarten, das die Entkernung der Region nicht hinnehmen wird. Zu einem Prüfstein wird die Vorlage für die Trentiner M5S- und Lega-Parlamentarier und Regierungsmitglieder. Denn mehr Autonomie bedeutet auch mehr Dezentralisierung, Effizienz und Bürgernähe, und das haben sich beide Regierungsparteien auf die Fahnen geschrieben.
Freilich geht der Gesetzentwurf der SVP in manchen Punkten nicht genügend weit: die direkte Demokratie wird nicht gestärkt, die Rolle des Landtags ebenso wenig, die Zuständigkeiten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und bei den Außenbeziehungen bleiben relativ schwach, es gibt keine verbesserte Regelung zur ethnischen Konkordanz in der Landesregierung, kein eigenständiges Verwaltungsgericht und Oberlandesgericht für Südtirol, es bleibt bei der zwingenden Zweinamigkeit bei den Ortsnamen usw. Insofern wird es unverzichtbar, dass auch der Landtag mit breiter Mehrheit ein Projekt zum Ausbau der Autonomie verabschiedet und in Rom einbringt.
(Erschienen auf SALTO am 21.6.2018)
SBB-Vorwahlen
Vorwahlen für den Landtag im UnternehmerverbandDieser Titel ist natürlich ein Fake, beim UVS ist das so gut wie ausgeschlossen. Doch der Bauernbund, auch Unternehmer, tickt anders ab: man bestimmt die eigenen Landtagsabgeordneten über interne Wahlen.
Per Briefwahl wird der SBB im Dezember und Jänner Vorwahlen abhalten. Keine Mitgliederbefragung, kein Wahlkampf, sondern eine „Basiswahl“ der gut 21.000 SBB-Mitglieder mit präzisem Reglement. Dabei sind einige Kandidaten fix gesetzt, nämlich die jetzigen Abgeordneten, während die Bezirksbauernräte maximal zwei Kandidaten nominieren können. Sofern man es schafft, 500 Unterstützer zu finden, ist sogar eine Selbstkandidatur möglich. Dafür haben sich schon der Freiheitlichen-Obmann Reber-Leiter und C. Mitterhofer von der STF gemeldet. Die Vorgewählten werden also nicht alle auf der SVP-Liste antreten.
Entspricht der SBB damit seinem statutarischen Auftrag, bäuerliche Anliegen auch politisch weiterzutragen? Mag sein, denn bisher ist man in Symbiose mit der SVP ganz gut gefahren. Doch entspricht man damit auch demokratischen Ansprüchen, die ein Unternehmerverband zu wahren hätte? Im SBB-Statut steht nämlich nichts davon, dass der SBB Kandidaten für Landtagswahlen zu nominieren und Parteien entsprechende Vorgaben zu erteilen habe. Es steht auch nichts drin, dass dies praktisch immer nur eine Partei sein darf. Andererseits steht auch im Statut der SVP nichts von einem Recht von irgendwelchen Verbänden, Kandidaten vorzugeben.
In der Selbstdarstellung des SBB steht tatsächlich: „Die Interessenvertretung auf politischer Ebene erfolgt durch die Entsendung von Vertretern des Bauernbunds auf Gemeinde-, Bezirks- , Landes- Staats- und Gemeindeebene.“ Gut zu wissen, dass auch Dorfmann vom SBB ins Europaparlament „entsandt“ worden ist, der Form halber halt über den Umweg der SVP und allgemeiner Wahlen. Oder ist der SBB eigentlich eine nicht deklarierte Bauernpartei?
Die Bauernbundsvorwahlen entsprechen einer ständestaatlichen politischen Kultur, die in Tirol eine gewisse Tradition hat. Einen solchen Ständestaat gab es in Österreich sogar noch in den 1930er Jahren, als kein gewähltes Parlament und keine Parteien mehr existierten. In modernen Demokratien sind Vorwahlen Parteien vorbehalten. Wie demokratisch das abläuft, ist eine andere Frage. Doch wollte die SVP auch nur alle wichtigen „Stände“ bei ihrer Kandidatennominierung berücksichtigen, wäre die Liste rasch voll: sie müsste neben dem Bauernbund zumindest auch Kandidaten der übrigen Unternehmerverbände und Gewerkschaften akzeptieren. Dann wären wir wieder in einer Art modernem Ständestaat.
SBB-Vorwahlen für Bauernkandidaten der SVP sind unvereinbar mit der Überparteilichkeit eines Verbands, mit freien Wahlen und dem Parteienpluralismus. Landtagsabgeordnete erhalten ein Mandat für die Vertretung der gesamten Wählerschaft. Abgesehen von diesem Bruch mit Spielregeln der Demokratie, sind auch die Regeln dieser Vorwahlen undemokratisch: Warum gibt es für die Kandidatur solch hohe Hürden? Warum starten die jetzigen Abgeordneten als Fixkandidaten? Warum haben die SBB-Bezirke ein eigenes Vorschlagsrecht, wenn eine „Basiswahl“ angesagt ist?
Wie recht hat Sigmund Kripp, wenn er schreibt, der SBB solle sich – wie in andern Ländern und Regionen der Brauch – darauf beschränken, die Bauernkandidaten aller Parteien und deren Programme gleichberechtigt darzustellen. Dann wäre es den Wählerinnen überlassen, nach Wissen und Gewissen den geeignetsten Kandidaten anzukreuzen. Wenn der SVP-interne Landwirtschaftsausschuss Kandidaten nominiert ist das eines, wenn ein öffentlich geförderter Verband eine Partei als Vehikel nutzt, ist das etwas anderes. Andernfalls müssten beide Organisationen ihre Satzungen anpassen.
(erschienen auf SALTO 10.11.2017)
Neue Studie zur Überqualifikation der Ausländer
Zuwanderer: die Bedeutung der deutschen Sprache wird immer noch stark unterschätztNur 9% der ausländischen Zuwanderer in Südtirol haben laut einer kürzlich erschienenen, breit angelegten Studie (Paolo Attanasio, Ungenutztes Humankapital - Qualifikationen von Zuwanderern in Südtirol als Schlüssel für deren Integration am heimischen Arbeitsmarkt, apollis 2013, EU-15-BürgerInnen sind in der Studie nicht erfasst) ihre Deutschkenntnisse besser ausgebaut als das Italienische. Drei Viertel von ihnen sprechen Italienisch gut oder halbwegs gut, aber nur 29% können sich laut Selbsteinschätzung zumindest halbwegs gut auf Deutsch verständigen. Dabei leben die befragten Ausländerinnen zu 71% seit über 8 Jahren im Land.
Kein Wunder, ließe sich schließen, dass 35% wegen mangelnden Deutschkenntnissen auf Probleme bei der Arbeitssuche stoßen, wie in der Studie ermittelt, aber nur 22% wegen zu geringen Italienischkenntnissen. Anscheinend schätzen Zuwanderer, vor allem aus Nicht-EU-Ländern, Gewicht und Bedeutung der deutschen Sprache in Südtirol falsch ein. Obwohl die allermeisten längerfristig hier bleiben wollen, hat nur ein Viertel der Zuwanderer Sprachkurse besucht und davon wieder ein geringerer Teil Deutschkurse. Warum wagt man sich nicht ans Deutschlernen? Vielleicht aus der Annahme heraus, die Staatssprache würde ohnehin von allen verstanden. Südtiroler - mich eingeschlossen - verstärken diese unter Ausländern verbreitete Annahme, indem sie oft ganz automatisch mit Zuwanderern Italienisch reden. Dass in Südtirol aber die eigenen beruflichen Chancen mit ausreichend Deutschkenntnissen zusammenhängen können, muss vielfach erst durchsickern. Vor allem wenn man den im Heimatland erlernten Beruf hier anwenden, Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen und einen besser qualifizierten Job finden will, geht das nicht ohne vertiefte Kenntnis der Landessprachen. Natürlich müssen auch Arbeitgeber und öffentliche Hand dafür bessere Rahmenbedingungen schaffen, aber ohne eigene Anstrengung geht es nicht.
Die Fehleinschätzung der Bedeutung der deutschen Sprache wirkt sich in den Familien der Zuwanderer auch auf die Folgegeneration aus, was sich in den Zahlen der Schuleinschreibungen widerspiegelt. 2011/12 hatte die deutsche Berufsbildung einen Migrantenanteil von 4,3%, die italienische Berufsausbildung von 37%. Der Anteil der ausländischen Schüler in der Mittelschule ist von 2002 bis 2011/12 in der deutschen Schule von 1,2 auf 4,9% gestiegen, in der italienischen Schule von 9,4 auf 22,1%. Deutsch kann man natürlich auch in der italienischen Schule und außerhalb der Schule erlernen. Dennoch ist eine gewisse Schieflage nicht zu übersehen, denn die Integration der Zuwanderer in die Südtiroler Gesellschaft und ihr sozialer Aufstieg kann - mal abgesehen von 2-3 Städten - nicht mehr nur übers Italienische gelingen.
Erschienen auf SALTO 2013
Ein Gegenvorschlag zum Appell der 40 Historiker
Den Duce in den UntergrundDer Appell der rund 40 Historikerinnen zur Historisierung des Duce-Frieses am Gerichtsplatz, ohne das Werk selbst zu zerstören, war überfällig. Leider kommt er sehr spät, 54 Jahre nach der Vervollständigung des Piffrader-Werks, und erst als Reaktion darauf, dass der Landeshauptmann und der Kulturgüterminister sich einen Ruck gegeben haben und Hand daran legen lassen. So beschwören die Wissenschaftler ihr Wissen und ihre ethische Verantwortung, doch die unkommentierte Botschaft der Kontinuität, die das ganze Ensemble des Gerichtsplatzes Jahrzehnte lang ausgestrahlt hat (inklusive nächtlicher Bestrahlung), scheint nicht gestört zu haben. „Die Monumente der faschistischen Epoche“, schreiben die Historiker, „sollten nicht mehr Ausdruck von Identitäten und als Anstoß von Gegen-Identitäten dienen, sondern endlich radikal und wirkungsvoll historisiert werden.“ Gut so, lassen sie denn keinen Zweifel daran, dass ein Denkmal, das den Faschismus verherrlicht, Krieg, Rassismus und Gewalt glorifiziert, anders als bisher einzuordnen gehört. Doch warnen sie eindringlich davor, das Piffrader-Fries zu demontieren und an einen anderen Ort zu verbringen. Informationstafeln sollen genügen. Denkmäler wirken aber, neben der künstlerischen Gestaltung, gerade auch durch Material, Position, Größe und Wucht. Seine Ausmaße und dominante Position an der Fassade des Finanzamtes sind es, die dem Platz das Gepräge eines faschistischen Aufmarschplatzes geben. Nicht von ungefähr werden dort höchst selten Feste, Konzerte oder Märkte abgehalten. Den einzigen Grund für die Nicht-Entfernung, den die Historikergruppe nennt, ist jener, dass eine Abnahme seinen öffentlichen Wert steigern und zum emotionalen Objekt erheben würde. Das klingt so, als würde ein Duce-Denkmal im Museum die Gefühle der Mitbürger beleidigen, hoch oben am öffentlichen Gebäude aber nicht. Da auch bundesdeutsche Historiker diesen Appell mittragen, frage ich, bei welchen nationalsozialistischen Denkmälern man so vorgegangen ist und wo diese stehen. Wenn man solche Vergleiche als unpassend abtut, frage ich weiter, ob nicht auch Mussolinis Verbrechen ausreichen, ihn als Monument aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.
Gerade der Kontext eines Museums oder eines Mahnmals wäre die wirklich deutliche Historisierung, doch das Fries an seinem jetzigen Ort kombiniert mit einer Informationstafel ist kein Mahnmal. Diese Forderung passt wieder nur in eine Tradition der Verharmlosung, die es unseren italienischen Mitbürgern nicht zumutet, einen deutlichen Strich zwischen faschistischer Vergangenheit und der heutigen Werthaltung einer demokratischen Gesellschaft zu ziehen. Zudem gibt es in Bozen keinen Platz, der wirklich im Zeichen eines Mahnmals steht. Im Gegenteil: wenige kleine Denkmäler erinnern an die Verfolgten, die Mauer des SS-Durchgangslagers steht irgendwo weitab, doch zwei große Plätze präsentieren sich genauso, wie sie ihre faschistischen Auftraggeber haben wollten. Überall in der Welt haben sich neue Demokratien von ihren jüngsten Diktatoren distanziert, indem sie deren Selbstverherrlichungszeugnisse entfernten. In Bozen gibt es kein von allen Sprachgruppen gemeinsam getragenes Museum für Zeitgeschichte, und das Finanzamt selbst eignet sich nicht als Gedenkstätte. In dieser Situation muss Distanzierung mindestens bedeuten, den Tätern nicht mehr Gewicht und Sichtbarkeit zu geben als den Opfern: den italienischen Demokraten, den unterworfenen Afrikanern, den deportierten Juden, den überfallenen Nachbarvölkern, den nationalen Minderheiten usw. Berlin hat dem Holocaust-Denkmal einen ganzen Platz gewidmet. Ein bestehendes Denkmal für die Verfolgten auf den Gerichtsplatz zu stellen wäre das Mindeste. Den Piffrader-Duce gleichzeitig in eine öffentlich zugängliche Gruft unterhalb desselben Gebäudes zu versenken und ihn bildlich dem Unheil gegenüberzustellen, das er angerichtet hat, würde einer solchen deutlichen Distanzierung und modernen Erinnerungskultur entsprechen, unter dem Motto: den Duce versenken, aber die Lehren aus dem Faschismus nicht vergessen, und den Platz dem Gedenken seiner Opfer widmen.
Erschienen auf SALTO 14.2.2011
Abschluss-Symposium zu Bildungsprojekt zur Autonomiereform
Mit mehr Demokratie zu einer vollständigen AutonomieDie Südtirol-Autonomie ist eine permanente Baustelle, an der die paritätischen Kommissionen und einige Parteispitzen und Parlamentarier laufend arbeiten. Auch ein kompletter Verfassungsgesetzesvorschlag zur Vervollständigung der Autonomie seitens der SVP liegt dem Parlament schon vor. Der Landtag als Spiegel des politischen Pluralismus in Südtirol und noch weniger die Bürger und Bürgerinnen hatten auf dieser Baustelle bisher kaum Mitspracherechte. Wenn die Autonomiereform allerdings ohne Bürgerbeteiligung erfolgt, schlägt sich dies unweigerlich auch im Ergebnis nieder, etwa in fehlenden Bestimmungen zu neuen demokratischen Spielraum.
Eine 6-monatige, von SBZ und POLITiS mit Unterstützung des Landes abgehaltene Veranstaltungsreihe hatte mit rund 30 Experten versucht, auszuloten, wo bei der Südtirol-Autonomie Reformbedarf besteht und mit welchen Verfahren Bürgerinnen besser daran mitwirken können. Politiker, Wissenschaftlerinnen und engagierte Bürger haben überlegt, wie und wo man die heutige Autonomie gemeinsam weiterentwickeln soll und kann. In einer Online-Umfrage ist ein Meinungsbild zu möglichen Reformschritten eingeholt worden, die Ergebnisse der Gesamtveranstaltung sind in einem Abschlussband gesammelt worden, der zum Symposium erscheint. Das Symposium "Gemeinsam unsere Autonomie ausbauen" am kommenden Freitag, 9.5., 17 Uhr (Altes Rathaus Bozen, Lauben 30) gibt Gelegenheit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Dabei hat dieses "gemeinsam" eine zweifache Bedeutung: zum einen nämlich einen Reformprozess auf den Weg zu bringen, der von politischen Vertretern und Bürgerinnen gemeinsam getragen wird, also mit möglichst weitreichender Bürgerbeteiligung. Und zum andern ein Reformprojekt zur Autonomie starten, das gemeinsam von den Sprachgruppen, nicht nur von einzelnen Parteien und einigen Experten erstellt und durchgesetzt wird. Beides wäre ein Novum für die Südtiroler Politik. Der von LH Kompatscher angekündigte Autonomie-Konvent könnte den institutionellen Rahmen dafür schaffen. Im Hinblick darauf können Bürger und Bürgerinnen vorab ihre Maßstäbe formulieren, die an ein gut geregeltes demokratisch-partizipatives Verfahren anzulegen sind. (SALTO, 5.5.2014)
Gemeindeordnung der Region
Weichenstellung für bessere Bürgerbeteiligung im RegionalratKommende Woche diskutiert der Regionalrat einen Gesetzentwurf des SVP-Abgeordneten Noggler zur Neufassung der Gemeindeordnung, für welche immer noch die Region zuständig ist. Dieses wichtige Gesetz schafft den Rechtsrahmen für alle Gemeinden unter Wahrung der verfassungsrechtlich verbrieften Gemeindeautonomie.
Ausgehend von der regionalen Gemeindeordnung gibt der Gemeindeverband Mustersatzungen oder Empfehlungen vor, die in Südtirol von den allermeisten Gemeinden zum Großteil übernommen werden. Nur wenige Gemeinden nutzen den statutarischen Spielraum, um bessere Volksabstimmungsregeln und Bürgerbeteiligungsverfahren zu schaffen. Doch ein Mindeststandard an derartigen Bürgerrechten wie z.B. niedrigere Unterschriftenhürden, kein Beteiligungsquorum, die Briefwahl, sollten in der ganzen Region gelten.
In diesem Sinne hat der M5S einige hundert Abänderungsanträge zwecks Ausbau der kommunalen Demokratie eingebracht, die vor dem 8.12. behandelt werden müssen, wenn die Reform noch 2014 unter Dach und Fach kommen soll. Diese Vorschläge würden der direkten Demokratie im Land einen überfälligen Qualitätssprung verschaffen, deshalb hier einige der wichtigsten.
In den Gemeinden soll die Statutsinitiative eingeführt werden. Heute haben die Gemeindebürgerinnen keine Möglichkeit, von sich aus das Statut per Volksbegehren abzuändern. Das staatliche Rahmengesetz behält dieses Recht ausschließlich den Gemeinderäten vor. Damit fehlt ein zentrales Recht des Bürgers als Souverän in der Demokratie. Genauso wenig können Bürger bei Statutsänderungen durch den Gemeinderat mit dem Referendum ein Veto einlegen.
Eine Neuheit wäre die Möglichkeit der Abwahl des Bürgermeisters, des Gemeindeausschusses oder einzelner Assessoren. Was heute nur über den Weg eines Misstrauensvotums erfolgen kann, soll in Zukunft auch von mindestens 15% der Bürger erwirkt werden können. Die Abberufung aus dem Amt (recall) wird in den USA und in der Schweiz praktiziert. Ein Misstrauensantrag gegen den Gemeindeausschuss soll künftig in den Gemeinderäten auch von 2% der Bürger, nicht nur von einem Viertel des Gemeinderats eingebracht werden können.
Viele Gemeinden der Region sehen heute zu hohe Unterschriftenhürden vor. Nach bayrischem Vorbild sollen die Unterschriftenhürden abgesenkt und der Gemeindegröße angepasst werden. In Gemeinden bis 3.000 Einwohner sollen nicht mehr als 8%, in Gemeinden von 3000-10.000 Einwohner nicht mehr als 5%, in Gemeinden ab 10.000 Einwohner nicht mehr als 3% der Wahlberechtigten unterschreiben müssen. Das Beteiligungsquorum könnte in Zukunft in allen Gemeindesatzungen gestrichen werden, wenn die Gemeindeordnung dies vorgibt. Bisher haben nur 11 Südtiroler und zwei Trentiner Gemeinden dieses Quorum ganz abgeschafft.
M5S will vor allem die beiden Grundverfahren der direkten Demokratie, Volksinitiative und bestätigendes Referendum generell zum Recht aller Gemeindebürger machen. Dies ist bisher nur in Kurtatsch und Mals geschehen. Diese beiden Formen müssten immer rechtsverbindliche Wirkung haben, während nur die Volksbefragung keine rechtliche Bindungskraft haben muss.
Schließlich will der M5S auch generell das Recht auf Briefwahl einführen, das in den Abänderungsanträgen detailliert beschrieben wird. Dieses Recht, in Südtirol auf Gemeindeebene erstmals in Mals im August 2014 angewandt würde Kosten sparen, und die Beteiligung erhöhen. Weitere Anträge des M5S betreffen das Wahlrecht, die Vergütungen, die Mandatsbeschränkungen, die Bestimmungen zum Verfahren der Fusion von Gemeinden, die derzeit das Hauptthema der Gemeindepolitik des Trentino bildet.
SALTO, 28.11.2014
Global Forum Südtirol
Originell, aber widersprüchlichVon zwei Zielen geht das gestern in Bozen von C. Girardi und Prof. R. Eichenberger vorgestellte „White Paper“ für Reformen des politischen Systems Südtirols aus: zum einen die Notwendigkeit der Stärkung der politischen Vielfalt, zum anderen mehr politische Konkordanz und weniger Polarisierung. Die beiden Autoren wollen dafür einige Bausteine des Systems der Schweizer Kantone auf Südtirol übertragen, ohne jedoch das Autonomiestatut zu ändern. Das ist kaum zu bewerkstelligen, weil die Rechtsordnungen zu verschieden sind. Somit hätten die Autoren in ihrem mutigen Entwurf durchaus auch Hand ans Statut anlegen können, zumal die Statutsreform im nächsten Landtag diskutiert wird, höchstwahrscheinlich schon vor der nächsten Reform des Landtagswahlrechts.
Originell und zukunftsweisend sind die Reformvorschläge von Girardi und Eichenberger gewiss, allerdings stecken auch einige Widersprüche und Ungereimtheiten drin. Hier einige Beispiele:
Die Einführung von 10+1 Landtagswahlkreisen soll zu einer Aufwertung der Bezirke und zur Stärkung der Gesamtverantwortung fürs Land führen (über den landesweiten Wahlkreis für 8 der 35 Mandate). Die Nachteile überwiegen eindeutig: das in Südtirol ohnehin schon zu starke Bezirksdenken würde bei den landespolitischen Themen – und diese stehen auf der Agenda des Landtags – nochmals ausgebaut zu Lasten der Gesamtverantwortung fürs Land. Zwei Kategorien von Abgeordneten würden geschaffen: die einen, die an ihren Bezirk denken; die anderen, die ans Land denken und Landesrat werden wollen. Zudem könnte eine Partei der relativen Mehrheit (etwa die SVP) dann gleich in allen Bezirken abräumen, z.B. auch in Bozen, also das Gegenteil von mehr Parteienvielfalt.
Die Rotation des Landeshauptmanns unter den Regierungsmitgliedern (jährlich, nach Schweizer Muster) könnte die kollegiale Regierungsführung stärken und damit die politische Konkordanz. Auch ein Ladiner und eine Italienischsprachige kämen mal dran. Allerdings wäre dies beim heutigen Statut nur höchst umständlich zu bewerkstelligen. Auf Basis eines Koalitionsabkommens müsste der Landtag Jahr für Jahr einen neuen LH wählen, der sich dieselbe Regierungsmannschaft zusammenstellen müsste. Hauptmanko jedoch: in der Schweiz werden die Landesräte (Regierungsmitglieder der Kantone) direkt und klar getrennt von den Landtagsabgeordneten (Kantonalräte) gewählt. Nur in diesem Fall klappt es mit der Rotation. Eine solche Reform, die nur mit einer Statutsänderung möglich ist, schlagen aber Eichenberger und Girardi gar nicht vor.
Wichtig und interessant jedenfalls das Panaschieren, nämlich die Möglichkeit der listenübergreifenden Vorzugsstimmenabgabe im Landtagswahlrecht. Diese in der Schweiz und Deutschland weit verbreitete Möglichkeit ist von Paul Köllensperger für die Gemeindewahlen (Region) und für den Landtag vorgeschlagen, doch von der SVP vom Tisch gewischt worden.
Die Wahlbeteiligung der rund 40.000 Auslandssüdtiroler (tatsächlich wählen nur an die 8000) soll durch die Einführung des e-votings erhöht werden. Das ist gut und recht, und wiederum macht die Schweiz die Machbarkeit dieses Systems vor. Doch wäre auch schon geholfen, wenn nicht nur die Auslandssüdtiroler, sondern alle Wahlberechtigten per Post wählen könnten. 80% der Schweizer wählen per Post. Zudem: wenn das e-voting eingeführt würde, warum nicht gleich für alle?
Neben den 40.000 Auslandssüdtirolern gibt es bei uns auch 50.000 ansässige Ausländer, die im Unterschied zu zahlreichen Schweizer Kantonen nicht wahlberechtigt sind. Das Global Forum hätte zumindest einige Forderungen für diese große Gruppe von Ansässigen stellen müssen.
Schließlich ein Knackpunkt, den Girardi und Eichenberger unbearbeitet lassen: wie kann man die ethnische Repräsentativität der Landesregierung und damit die ethnische Konkordanz stärken? Zwar gibt es die Pflicht der Vertretung der beiden größeren Sprachgruppen (nicht der Ladiner! Auf diese Reform haben die SVP-Ladiner in ihrer Statutsnovellierung 2017 verzichtet), aber nicht als Vertreter der Mehrheit der italienischsprachigen Abgeordneten im Landtag. Seit 1993 vertritt der Italiener in der Landesregierung nur eine Minderheit der italienischen Wählerschaft, derzeit überhaupt nur einen Bruchteil. Zu diesem Zweck genügt nicht eine Reform des Landtagswahlrechts, vielmehr braucht es institutionelle Vorkehrungen auf der Ebene des Autonomiestatuts.
Die Schweiz kann uns fürwahr Vieles lehren, allein an diesen Vorschlägen kann noch nachgebessert werden.
SALTO, 27.7.2018
Einkommensungleichheit
Gesetzlicher Mindestlohn als Ausweg?Die Einkommensverteilung in Südtiroler wird immer schräger. Nur über die Kollektivverhandlungen ist kaum Abhilfe zu schaffen. Als Ergänzung bietet sich ein gesetzlicher Mindestlohn an.
Die Entwicklung der Einkommensverteilung stand im Zentrum der jüngsten Tagung des AFI, das einige Schätzungen zur Konzentration der Einkommen in Südtirol zusammengetragen hat. 10% der Bezieher der niedrigsten Einkommen erklären 0,4% des Gesamteinkommens, die 10% Bezieher der höchsten Einkommen halten dagegen 34,3% der insgesamt erklärten Einkommen. Allerdings beziehen sich diese Daten auf die Steuererklärungen von Einzelpersonen, worin viele niedrige Einkommen von Personen enthalten sind, die mit anderen Einkommensbeziehern in einem Haushalt leben. Auch ohne die Einkommenssteuerdaten näher zu analysieren zu können, weist dies auf immer mehr Ungleichheit in der Einkommensverteilung hin. Hier die Tagungsunterlagen.
Grund dafür ist unter anderem, dass das Wachstum der Löhne mit den vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten nicht Schritt gehalten haben: der inflationsbereinigte Brutto-Jahresdurchschnittslohn der 167.000 Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft hat 2007-2012, also in 6 Jahren, um insgesamt 0,6% zugenommen (vgl. ASTAT), jener der öffentlich Bediensteten hat abgenommen. Stellt man die kalte Steuerprogression in Rechnung, haben die Arbeitnehmereinkommen insgesamt seit 2007 stagniert. Die Niedriglohnbezieher hatten in diesen Jahren besonders starke Lohneinbrüche hinzunehmen. Die Einkommensverteilung hat sich laut ASTAT (ASTAT 2015, Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Haushalte in Südtirol 2013-2014) deutlich zuungunsten der Arbeitnehmer verschoben.
Die ASTAT-Daten zur Jahresbruttoentlohnung zeigen auf (Öffentlicher Dienst und Landwirtschaft ausgeklammert), dass ein Fünftel der Arbeitnehmer Südtirols in der Privatwirtschaft absolute Niedriglöhne bezieht. Umverteilungsmechanismen wie die progressive Einkommenssteuer und einkommensabhängige Sozialleistungen gleichen die Dynamik bei den Primäreinkommen nicht mehr aus. Die Einkommensschere zwischen Arm und Reich öffnet sich: Südtirol wird reicher, aber dieser Reichtumszuwachs ist immer ungleicher verteilt. Der Anteil der armutsgefährdeten Personen liegt 2013 bei 19%.
In Südtirol müssten eigentlich eher Löhne nach österreichischem Standard gezahlt werden, um den Arbeitnehmerfamilien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern, und nicht der kollektivvertragliche Mindestlohn, der für Italien von Catania bis zum Brenner gilt. Zwar gibt es Betriebsabkommen, die Zusatzvergütungen und Prämien vorsehen, doch die eigentlich nötigen Landeszusatzabkommen werden oft für ganze Sektoren nicht abgeschlossen. In einer kleinbetrieblich strukturierten Wirtschaft wie der Südtiroler Wirtschaft wären solche Zusatzverträge entscheidend, um die Entlohnung sowohl dem Produktivitätswachstum als auch den Lebenshaltungskosten in Südtirol anzupassen. Die Südtiroler Gewerkschaften haben jedoch nicht die nötige Verhandlungsmacht, um diese Zusatzentlohnung durchzusetzen, denn das Kollektivvertragssystem ist in Italien stark zentralisiert.
Der Ausweg aus diesem Dilemma ist ein gesetzlicher Mindestlohn, den in Südtirol nur das Land festlegen kann. In die Tarifautonomie kann das Land nicht eingreifen, doch könnte es die Zuständigkeit für die Festlegung sektorenspezifischer Mindestlöhne erhalten. Diese können über den gesamtstaatlichen kollektivvertraglichen Mindestlöhnen liegen. Davon können die Sozialpartner dann im Rahmen des Landeszusatzabkommens immer noch nach oben abweichen. Damit kann verhindert werden, dass sich in Südtirol Niedriglohnbereiche breitmachen (wie im Gastgewerbe, Handel und anderen Dienstleistungen heute schon der Fall). Südtirol könnte hier auch unabhängig von einer entsprechenden gesamtstaatlichen Regelung seinen eigenen Weg sozialen Ausgleichs gehen können, wie z.B. beim Lehrlingswesen. Dies müsste allerdings im neuen Autonomiestatut als neue Zuständigkeit verankert werden.
In Deutschland gilt ein solcher genereller Mindest-Stundenlohn seit Anfang 2015 und zwar 8,50 Euro netto pro Stunde. Italien ist hingegen eines der wenigen EU-Mitgliedsländer, die noch keinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt haben. Dies wird damit begründet, dass in Italien im Rahmen der Tarifautonomie sektorenbezogene Mindestentlohnungen kollektivvertraglich festgelegt werden.
Südtirol hat bereits für eine gewisse Entlastung der Einkommen bis 28.000 Euro beim regionalen IRPEF-Zuschlag gesorgt, doch ist das zu wenig. Es müsste auch beim noch wichtigeren Hebel anzusetzen, nämlich dem Lohn. Im Klartext: Südtirol muss über den kollektivvertraglichen Mindestlohn hinaus eine den hiesigen Lebenshaltungskosten und Produktivitätsniveaus angemessene Mindestlohnregelung einführen. Der ASGB fordert z.B. in seinem Grundsatzpapier 2014-2018 die flächendeckende Einführung eines kollektivvertraglichen Mindestlohns von 1.500 Euro brutto im Monat (ASGB 2015). Doch weil dies per Landes-Zusatzvertrag nicht durchsetzbar ist, ist das Land in die Pflicht gerufen, um zunächst auf Ebene des Autonomiestatuts die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und dann per Landesgesetz den Mindestlohn für jeden Sektor selbst festzulegen. Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Gewerkschaften beim Autonomie-Konvent. Auf diese und zahlreiche weitere Neuerungen im Autonomiestatut geht auch mein neues Buch ein, das am 17.6., 10 Uhr, im Kolpinghaus vorgestellt wird.
SALTO, 15.6.2016
Mehr Kaufkraft
Gesetzlicher Mindestlohn für Südtirol sinnvollIn die Tarifhoheit der Sozialpartner kann das Land nicht eingreifen, aber Südtirol könnte die Zuständigkeit für die Festlegung eines eigenen gesetzlichen Mindestlohns anstreben.
In ihrem vor 3 Wochen präsentierten „Pakt für Südtirol“ weisen die Konföderierten Gewerkschaftsbünde auf die seit 25 Jahren stagnierenden Reallöhne hin: ein beträchtlicher Teil der Arbeitnehmer bezieht nur den kollektivvertraglichen Mindestlohn laut nationalen Kollektivverträgen (z.B. im Handel, im Gastgewerbe, in gering qualifizierten Dienstleistungen) und ein Viertel der Arbeitsverträge sind befristet. Obwohl in Südtirol durchschnittlich etwas höhere Löhne als in Restitalien gezahlt werden, reicht die Kaufkraft für einen erheblichen Teil der Arbeitnehmer (30-40% laut AFI) nicht aus, die hierzulande relativ höheren Lebenshaltungskosten zu schultern.
„Es braucht ein Rahmenabkommen, das auf lokale Lohnerhöhungen abzielt, das das Recht auf Weiterbildung und ergänzenden Wohlfahrtsleistungen vorsieht, die auf Südtirol zugeschnitten sind. Der neu gewählte Landtag muss die lokalen Vertragsverhandlungen fördern,“ schreibt der SGB-CISL. Derartige Pflichten oder Anreize für die Unternehmen bei den Steuern (IRAP-Senkung) und bei den Subventionen (soziale und ökologische Auflagen) machen Sinn, reichen aber nicht aus. Denn der bloße Vertragsabschluss bedeutet noch nicht wesentlich höhere Löhne. Um in Südtirol ein Lohnniveau zu gewährleisten, das den hiesigen Lebenshaltungskosten, Immobilienpreisen und Produktivitätsniveaus angemessen ist, muss beim entscheidenden Hebel angesetzt werden, nämlich dem Lohn. Hier liegt der Haken. Landeszusatzabkommen für ganze Wirtschaftssektoren werden oft gar nicht abgeschlossen. Betriebsabkommen, die Zusatzvergütungen und Prämien vorsehen, kommen in vielen Betrieben nicht zum Tragen.
In die Tarifautonomie der Sozialpartner kann das Land nicht eingreifen, denn sie wollen dies selbst nicht. Doch könnte das Land Südtirol die Zuständigkeit für die Festlegung sektorenspezifischer Mindestlöhne für die in Südtirol Beschäftigten anstreben. Dann könnte das Land für jeden Sektor zumindest eine Untergrenze für die kollektivvertraglichen Löhne festlegen. Damit kann gerade im Bereich der Niedriglöhne das Lohnniveau in Südtirol auf ein menschenwürdigeres Niveau angehoben werden. Südtirol kann hier im Rahmen einer entsprechenden gesamtstaatlichen Regelung seinen eigenen Weg sozialen Ausgleichs gehen und dem Phänomen „Armut trotz Arbeit“ (working poor) entgegenwirken. Sonst bleibt die Forderung der Arbeitnehmer der SVP und anderer Kandidaten nach „Stärkung der Kaufkraft der Löhne“, ein frommer Wahlkampfwunsch.
SALTO, 18.10.2018
Koalition der SVP mit der Lega?
Ein Gebot ethnischer RepräsentativitätLange Jahre ging die Rede vom „disagio“ der Italiener in Südtirol. Zwischen Ressentiments wegen verlorener früherer Vormacht und herbeigeredeter, aber nicht bewiesener Diskriminierung war ein eher konkreter Grund dieser: seit 1993 hatte die SVP immer einen Koalitionspartner (PD und Vorgängerpartei) zum Koalitionspartner erkoren, der höchstens ein Viertel der italienischsprachigen Wählerschaft hinter sich wusste. Das führte bei den Italienern zu politischem Frust und steigender Wahlenthaltung unter dem Motto: „Noi possiamo votare chi vogliamo, tanto la SVP se ne frega.“
Die Statutsregelung sieht die Präsenz von mindestens einem Angehörigen der italienischen Sprachgruppe in der Landesregierung vor. Doch Koalitionspartner kann auch eine Ein-Personen-Partei oder ein einziger Abgeordneter mit italienischer Sprachgruppenzuordnung sein. Das Statut sieht nicht vor, dass zumindest die Hälfte der italienischsprachigen Landtagsabgeordneten hinter der Koalition stehen muss. Anders gesagt: dass die Landesregierung repräsentativ für die politischen Mehrheiten aller Sprachgruppen sein sollte, so wie im Landtag präsent. Ein Manko im Statut. Mit einem krassen Beispiel lässt sich dieses Manko verdeutlichen. Würde die SVP zur Territorialpartei werden und bei den nächsten Landtagswahlen auch einen Italiener durchbringen und 18 Landtagssitze erringen, könnte sie laut geltendem Statut allein regieren. Die Mehrheit der italienischen Sprachgruppe bliebe außen vor, neuer „disagio“ wäre vorprogrammiert.
Nun hat die italienische Sprachgruppe zum ersten Mal seit den Zeiten der DC vor 1990 wieder eine Partei gewählt, die sie zwar nicht in Stimmen gemessen mehrheitlich vertritt (die Lega hat 31.510 Stimmen erhalten). Dies kann von einer demokratischen Wahl nicht abgelesen werden. Aber in Landtagssitzen vertritt die Lega mit 4 Abgeordneten die Hälfte dieser Sprachgruppe. Ihr Anspruch aufs Mitregieren ist legitim, weil in Südtirol das Gebot ethnischer Konkordanz gilt.
Dieses Gebot kann man ganz eng auslegen, indem die deutsche Mehrheitspartei den bequemsten und kleinsten Partner auswählt oder indem sie mit einer italienischen Partei „a titolo etnico“ regiert. Man kann dieses Gebot aber auch demokratischer auslegen und damit dem im Autonomiestatut verankerten Prinzip der Gleichberechtigung der Sprachgruppen besser entsprechen. Das bedeutet, dass auch die Landesregierung die politischen Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Sprachgruppen abbilden müsste, nicht nur einen kleineren Teil der italienischen Sprachgruppe.
Somit ist es nicht nur ein Gebot ethnischer Konkordanz, sondern auch der Achtung der demokratischen Repräsentativität, jetzt eine Koalition zwischen Lega und SVP zu bilden. Aus welchen Gründen auch immer 35.150 Wähler die Salvini-Statthalter gewählt haben, sie bilden die Hälfte der Wählerschaft dieser Sprachgruppe ab. Wie früher das Votum für MSI und AN ist es ein Armutszeugnis für die italienische Sprachgruppe, aber halt ein demokratisches Votum, das es zu respektieren gilt. Für die SVP mag es manch anderen strategischen Grund geben, auf die Lega zu setzen (Fortschritte beim Autonomieausbau in Rom, Einvernehmen mit der Trentiner Landesregierung, Koalition mit nur einem Partner usw.) für die Oppositionsparteien gibt es dutzende gute Gründe, sich diese üble Achse von Putin, Orban, Strache, Wilders bis Le Pen vom Leib zu halten. In Südtirol ist es paradoxerweise ein Gebot ethnischer Konkordanz, bei der anstehenden Regierungsbildung dieses peinliche Votum der italienischen Sprachgruppe zu respektieren.
SALTO, 27.10.2018
90% der Gesetze von der Regierung
Demokratische Gewaltenteilung?Der Landtag ist Instanz der autonomen Gesetzgebung. Er verabschiedet zwar Gesetze, doch über 90% der angenommenen Gesetze der abgelaufenen Legislatur stammen von der Landesregierung.
Diese Tendenz wird in den Demokratien auf staatlicher und regionaler Ebene schon länger verzeichnet: die Parlamente schreiben immer weniger, die Regierungen immer mehr Gesetze. Das ist auch in Südtirol nicht anders, doch in der abgelaufenen Legislatur noch deutlicher geworden. Von 172 im Landtag behandelten Gesetzentwürfen stammten 103 (59,9%) von der Landesregierung, 3 von Bürgern per Volksbegehren, 12 (7%) von Abgeordneten der Mehrheitsparteien SVP und PD und 54 von der Opposition (31,4%). Mit Ausnahme eines zurückgezogenen Entwurfs sind sämtliche Regierungsvorlagen im Landtag genehmigt worden. Dieser ist somit vor allem eine Instanz zur Begutachtung und Verabschiedung von Texten, die Landesräte und ihre Mitarbeiter vorgeben. Über 90% der angenommenen Gesetze der abgelaufenen Legislatur stammen von der Landesregierung.
Welche Erfolgschance haben nun Abgeordnete, wenn sie sich ihrer Kernaufgabe der Gesetzgebung widmen? Alle von den Mehrheitsparteien eingebrachten Gesetzentwürfe sind, sofern nicht zurückgezogen, im Landtag angenommen worden. Die Bürger haben direkt keine Chance: alle drei per Volksbegehren eingebrachten Entwürfe fielen durch. Kaum besser ging es der Opposition: von 54 Gesetzentwürfen wurden 9 zurückgezogen und 44 in der Kommission oder im Plenum abgelehnt. Ein einziger Gesetzentwurf der Opposition schaffte die Verabschiedung, nämlich jener von Dello Sbarba zum Thermenhotel in Meran. Kein Wunder, dass einige Oppositionsparteien die Vorlage von Gesetzentwürfen praktisch aufgegeben haben, weil es nichts bringt. Der absolut fleißigste Gesetzesschreiber unter den Abgeordneten war Andreas Pöder mit 18 Vorlagen, gefolgt von den Grünen (15) und Urzì (8). Die Landtagsmitglieder mögen noch andere Aufgaben und Instrumente haben, beim Gesetzgeben sind sie jedenfalls, sofern in der Opposition, chancenlos.
Das Instrument der Anhörung von Fachleuten zwecks Vorbereitung einer Entscheidung über eine Gesetzesvorlage gehört zu den Rechten des Landtags, um sich ein besseres Bild über die anstehende Materie zu machen. Dieses Instrument wurde in der abgelaufenen Legislatur lediglich zwei Mal genutzt. Interessanter und wirksamer wäre hier das Instrument der Öffentlichen Anhörung (istruttoria pubblica), nämlich die auch für Bürger zugängliche Anhörung von Expertinnen, die von Mehrheit und Opposition gemeinsam beigezogen werden und somit für transparente und kontroverse Analyse und Bewertung eines Projekts sorgen. Dieses Verfahren gibt es auf Landesebene nicht und ist auch durch das neue Landesgesetz zur Partizipation nicht eingeführt worden.
Genauso wenig gibt es vor der Diskussion und Verabschiedung von Gesetzesvorlagen im Landtag die sog. Vernehmlassung. Dieses in der Schweiz übliche Verfahren bietet allen Institutionen, Verbänden und Organisationen die Chance zur Stellungnahme in transparenter und fairer Form. Der Gesetzentwurf wird dort ins Kantonalratsportal gestellt und direkt allen betroffenen Gruppen zugestellt, die binnen einer Frist ihre Stellungnahme öffentlich im Portal posten können. Wichtige Interessengruppen werden zu Anhörungen eingeladen, doch auch Einzelpersonen können sich zu den Vorlagen online äußern. In Südtirol wird nur der Rat der Gemeinden auf diese Weise regelmäßig konsultiert. Ansonsten behilft man sich seitens der Mehrheit der Konsultation hinter den Kulissen.
SALTO, 11.10.2018
ITALICUM u. Südtirol
ITALICUM zementiert auch Mehrheitsverhältnisse in der RegionÜberraschend wenige PD-Dissidenten haben sich vergangene Woche noch gegen das ITALICUM-Wahlgesetz gewehrt. Am Montag, 4.Mai, soll die Kammer das Gesetz endgültig verabschieden, damit es im Juli 2016 nach einem wahrscheinlich beantragten bestätigenden Referendum in Kraft treten kann.
Die Stichwahl zwischen zwei Parteien, die tatsächlich 30-35% der Stimmen erzielen, ist das große Novum. Wer die Stichwahl gewinnt, erhält dann 53% der Sitze (gleich 327 Sitze), unabhängig davon, wieviel er beim ersten Durchgang erzielt hat. Eine Art Siegerbonus oder Mehrheitsprämie, die für Europa höchst ungewöhnlich ist. Der Verfassungsgrundsatz der „Gleichwertigkeit der Stimmen“ (Art. 48 Verf.) wird damit ganz schön strapaziert. Die kleineren Parteien teilen sich dann die übrigen Sitze, sofern sie die Sperrklausel von 3% überwinden.
Sehr eingeschränkt ist die Möglichkeit der Vorzugsstimmenabgabe. In den 100 Wahlkreisen gibt es Spitzenkandidaten, die von den Parteizentralen benannt werden, beim PD nach Vorwahlen. Der Wähler hat zwar die Möglichkeit, zwei Vorzugsstimmen abzugeben, doch die Listenführer sind automatisch gewählt, darauf hat der Wähler keinen Einfluss mehr. Damit wird, wie beim PORCELLUM, ein hoher Teil des Parlaments (man spricht von 70%) nach wie vor direkt von den Parteien ernannt. Das System der blockierten Listen ohne Vorzugsstimmenabgabe war vom Verfassungsgericht verworfen worden.
Südtirol und das Trentino sowie das Aostatal erhalten mit dem ITALICUM ein eigenes Wahlsystem, zugeschnitten auf die SVP und den PD. Es werden je Provinz 4-Ein-Kandidaten-Wahlkreise geschaffen, die zur Grundverteilung der Mandate nach Geschmack der Mehrheitsparteien führen werden. In Südtirol voraussichtlich wie gehabt drei für die SVP und einen für den PD oder jedenfalls einen Italiener im Wahlkreis Bozen-Unterland. Die übrigen drei Sitze der 11 insgesamt in der Region zur Wahl stehenden Parlamentssitze werden nach dem Verhältniswahlsystem vergeben. Auch hier sieht es für die kleineren Parteien eher ungünstig aus, einen Sitz zu ergattern.
Eigentlich hätte man von einem halbwegs fairen Wahlrecht erwarten können, dass die für die Direktwahl in den einzelnen Wahlkreisen abgegeben Stimmen nicht mehr für die Vergabe der nach Verhältniswahlsystem vergebenen Sitze herangezogen werden (also eine Art Zweitstimme wie bei den deutschen Bundestagswahlen). Dem ist aber nicht so, denn es erfolgt eine teilweise Anrechnung der nach Mehrheitswahlrecht abgegebenen Stimmen. Wenn keine Liste 40% der Stimmen erhält, werden zwei von drei Sitzen der Mehrheitspartei zugesprochen. Der dritte Sitz geht an die nächststärkste Liste in der Region. Dabei werden nicht alle Stimmen der gewählten der Einer-Wahlkreise abgezogen, sondern nur jene Zahl, die notwendig war, um gewählt zu werden (scorporo parziale, Titel VI des Gesetzes). Damit fließen die überschüssigen Stimmen aus dem Mehrheitswahlrechts-Sitzvergabe in den Topf zur proportionalen Verteilung der drei nach Verhältniswahl zu vergebenden Sitze. Dies wirkt sich wieder zugunsten jener Listen aus, die schon die Einer-Wahlkreise gewonnen haben (voraussichtlich SVP und PD). Die SVP hat damit beste Aussichten, auch nach dem Verhältniswahlsystem einen weiteren Sitz zu erhalten.
Mit dem ITALICUM werden in der Trentino-Südtirol wie gehabt 10 von 11 Sitzen der Mehrheit zugewiesen (also 90%), obwohl diese Wahlkoalition bestenfalls 60% der Stimmen erzielt. Von einer realen Widerspiegelung der politischen Kräfteverhältnisse im Land kann keine Rede sein. Diese Sonderregelung für unsere Region ist nicht nur unfair, sondern auch ein Musterbeispiel eines für die normalen Bürger und Wählerinnen völlig unverständlichen Gesetzes: die politischen Grundregeln werden mit solchen Gesetzestexten zu einer Geheimwissenschaft für Parteitechniker.
SALTO, 2.5.2015
Öffentlicher Dienst
Der Staat schlankt abWährend die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Lokalverwaltungen nur mehr langsam steigt, schrumpft die Zahl der Arbeitsplätze beim Staat in Südtirol seit 2011 deutlich, vor allem bei der Polizei. Warum?
Vor allem wegen dem Proporz wird die Entwicklung der Beschäftigung im öffentlichen Dienst in Südtirol immer genau beobachtet. Laut vgl. ASTAT-Info Nr.3/2016 wird der Proporz bei den Lokalverwaltungen ziemlich streng eingehalten, während er bei jenem kleineren Teil der Staatsstellen nicht erreicht worden ist (58,3% der Mitarbeiterinnen Deutsche, 39,3% Italiener und 2,4% Ladiner). Der mit über 6.000 Bediensteten weit größere Teil des Staatsdienstes befasst sich mit der äußeren und inneren Sicherheit: Carabinieri, Polizisten, Soldatinnen, Geheimdienstleute und dergleichen. Über die Sprachgruppenverteilung gibt der Staat keinen Aufschluss, denn dem Proporz ist dieser Bereich nicht unterworfen. Allerdings hat es bei zahlreichen Wettbewerben für Staatsstellen einen chronischen Mangel an Bewerbern gegeben, vor allem seitens der Ladiner.
Insgesamt hat der Staatsdienst mit 3,6% der Erwerbstätigen (Ende 2014) keine große Bedeutung mehr für den Südtiroler Arbeitsmarkt. Die Entwicklung des staatlichen Personals ist aber nicht nur hinsichtlich des Proporzes interessant, sondern auch weil die wenigen vom Staat verwalteten öffentlichen Dienste für die Bevölkerung ganz schön wichtig sind, wie etwa die innere Sicherheit, die Justiz, die Finanzämter und die Sozialversicherungsanstalten. Bei einer wachsenden Wirtschaft und Unternehmenszahl, bei einem zunehmend komplizierten Steuersystem und immer mehr beanspruchten Justiz könnte man annehmen: der Staat braucht mehr Personal, um einen bürgerfreundlichen und effizienten Dienst zu leisten. Das Gegenteil ist der Fall: von 2011 bis 2014 hat der Staat über 1.000 Stellen gestrichen, und zwar in allen Bereichen mit Ausnahme des Heeres.
Im Gerichtswesen ist seit 2009 fast ein Sechstel der Stellen wegrationalisiert worden. Wer die Südtiroler Justizverwaltung von innen kennt, wird allerdings nicht behaupten, dass die Justiz jetzt schneller und rationeller arbeitet. Abseits von jeder Proporzdiskussion: hier leidet die Qualität des Dienstes für die Bürger. Weniger deutlich haben die Finanzämter eingespart, obwohl jeder Steuerzahler die elendslangen Wartezeiten z.B. bei der Bozner Steueragentur kennt. Sogar Unternehmer würden hier behaupten: es braucht eher mehr als weniger Personal, um einen effizienten, bürgerfreundlichen und zweisprachigen Dienst zu gewährleisten.
Am erstaunlichsten die Entwicklung bei der Polizei (es ist nicht klar, ob die Carabinieri zur Polizei oder zum Heer gezählt werden). Jedenfalls ist allein bei der Polizei in nur drei Jahren (2011-2014) ein volles Drittel der Stellen weggefallen. Warum? Laut ASTAT haben die Straftaten 2011-2013 sogar zugenommen. Es ist aber auch nicht bekannt, dass die öffentliche Sicherheit seit 2014 bedenklich abgenommen hat. Waren diese Polizisten schon vorher überflüssig oder sieht sich der Staat zu so radikalen Einsparungen gezwungen? Dann könnte er allerdings auch bei den in Südtirol stationierten Soldaten sparen, die im selben Zeitraum zugenommen haben. Denn „Feind“ ist hier zurzeit keiner in Sicht.
SALTO, 27.1.2016
Politikergehälter und direkte Demokratie
Politikergehälter direkt bestimmen - Das gehtDie Politikergehälter gehören wohlweislich zu jenen Sachbereichen, die die SVP aus ihrem Gesetz zur Bürgerbeteiligung von 2013 von jedem Zugriff durch Bürgerbeteiligung bewahrt wissen wollte. Nach den eklatanten Wirkungen der Pensionsregelung unseres Regionalrats versteht man noch besser, warum. Im Art. 8 dieses vom Volk am 9. Februar 2014 nicht bestätigten Gesetzes ist die "Regelung der finanziellen Zuwendungen an das Personal und die Organe des Landes" von jeder Mitbestimmung ausgeschlossen. Muss es aber nicht sein, die Verfassung schließt nur den Haushalt und die Steuern aus. Demokratisch angemessen wäre zumindest die Zulässigkeit eines bestätigenden Referendums zu den Diäten und Renten von Politikern, denn genauso wie die Parteienfinanzierung gehört dieser Bereich im weitesten Sinne zur "Regierungsform". Und diese Gesetze sind in Südtirol seit 2001 "verstärkte Gesetze", die dem bestätigenden Referendum unterliegen. Doch auch die direkte Bestimmung der Gehälter der Politiker beim Wahlakt ist technisch kein Problem.
Wie, das zeigt der Vorschlag des italienweiten Volksbegehrens "Quorumzero e più democrazia" vom Sommer 2012, das in Südtirol von gut 7.000 Bürgern mitunterschrieben und dem Parlament vorgelegt worden ist (www.paolomichelotto.it). Dort wird für die demokratische Festlegung der Politikergehälter eine Regelung vorgeschlagen, die bestechend einfach ist. In diesem Gesetzentwurf für eine Verfassungsreform wird vorgeschlagen, dass es den Wählern bei der Wahl des Parlaments zustehen soll, die Vergütung der Parlamentarier für die betreffende Legislatur festzulegen. Dabei soll diese Vergütung an das mittlere Einkommen der Bevölkerung geknüpft werden. Die Berechnung würde in der Praxis folgendermaßen erfolgen:
Das Jahreseinkommen pro Kopf der in Italien Ansässigen wird aus amtlichen Quellen (z.B. dem ISTAT) ermittelt. Es lag 2011 bei 22.000 Euro.
Beim Wahlvorgang hat jeder Wähler die Möglichkeit, den Multiplikator festzulegen, mit welchem dieses Durchschnittseinkommen multipliziert werden soll.
Am Ende der Stimmenauszählung wird der Durchschnitt aller angegebenen Multiplikatoren berechnet (aufgerundet auf eine Kommastelle) und auf das betreffende Durchschnittseinkommen angewandt.
Beispiel: würde ein durchschnittlicher Multiplikator von 3,5 ermittelt, beliefe sich die Vergütung der Parlamentarier auf 3,5 x 22.000 Euro= 77.000 Euro im Jahr.
Mit dieser Lösung würde die politische Vertretung direkt von den Wählern und Steuerzahlern mitbestimmt, und damit wieder stärker zu einem Dienst an der Allgemeinheit werden, nicht der Aneignung von Privilegien in Selbstbedienungsmanier dienen.
Die Regelung ist durchaus auf die Südtiroler Gesetzgebung und Politik übertragbar. Das Jahreseinkommen pro Kopf wird amtlicherseits vom ASTAT geliefert. Jeder Wähler kann bei Landtagswahlen auf einer gesonderten Karte den Multiplikator angeben, mit dem er das durchschnittliche Jahreseinkommen für die gewählten Abgeordneten multiplizieren will. Der mathematische Durchschnitt aller einzelnen Multiplikator ergibt den "Landesmultiplikator". Demokratischer geht es gar nicht. Die Regelung hätte obendrein den Vorteil, dass den Kandidaten vorab gar nicht bekannt ist, welches Gehalt sie im Falle ihrer Wahl beziehen. Die finanzielle Vergütung ihres politischen Dienstes kann damit nicht mehr für Einsatz und Kandidatur entscheidend sein, der Dienst an der Allgemeinheit tritt in den Vordergrund. Und das können die Bürger auch zu Recht erwarten.
SALTO, 4.3.2014
Sprachbarometer
Südtirol auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit?Wenn es eine Publikation gibt, die Südtirols Sprachlandschaft im Detail aufschlüsselt, dann ist es der alle 10 Jahre erscheinende ASTAT-Sprachbarometer,
Diesmal bei den Fragestellungen noch breiter und tiefergehend in der Analyse ist diese Publikation ein Muss für jeden, der sich mit Sprachenpolitik in unserem Land auseinandersetzt.
Die Zwei- und Mehrsprachigkeit ist hierzulande traditionell eines der spannendsten Themen. Der Sprachbarometer musste zunächst entscheiden, was eine Muttersprache ist. Ist es die Erstsprache, die Selbstzuordnung oder die tatsächliche Sprachkompetenz? Die Befragten konnten das selbst entscheiden, konnten demnach auch zwei oder drei Sprachen nennen. Das ASTAT-Wissenschaftlerteam (Haller, Gosetti, Lombardo, Siller) verweist aber auch auf die wissenschaftlich präzisere Lösung, die Kanada bei seiner Volkszählung anwendet. Eine Person hat demzufolge zwei Muttersprachen, wenn die beiden Sprachen gleich häufig verwendet werden und wenn die Person sie immer noch beherrscht. Es wird manche überraschen, dass nur 5,3% der Südtiroler zwei Erstsprachen angeben. Der Anteil der Personen mit zwei Erstsprachen ist unter „Italienern“ und „Deutschen“ mit 4,6% gleich hoch.
Auch die Art der Zweisprachigkeit bei Erstsprachen (Familiensprachen) streut seit Beginn der neuen Migration immer stärker. Die klassische Kombination Deutsch-Italienisch bildet 3,8% (15.900 Personen) bei insgesamt 5,6% auf die Grundgesamtheit. Fast 1% machen die Familien mit der Kombination „Italienisch-andere Sprache“ aus. Naturgemäß gibt es mehr Personen mit zwei Erstsprachen in den Gemeinden mit einem beträchtlichen Italieneranteil.
Aufschlussreich auch die Ergebnisse des Sprachbarometers auf die Frage, welcher Sprachgruppe sich die Südtiroler, die zwei Erstsprachen haben, zugehörig fühlen. Es hat den Anschein, dass sich diese Personen quantitativ so aufteilen, wie die Sprachgruppen insgesamt, etwa bei der offiziellen Zugehörigkeitserklärung. Nur 2.000 Personen (12,5% dieser Gruppe) fühlen sich keiner der drei Gruppen zugehörig.
Beim Thema Beherrschung der Zweitsprache ist es kein Novum, dass fast alle Deutschsprachigen in gewissem Maß Italienisch sprechen. Aber ganz positiv hervorzuheben ist: 2014 sprechen zwei von drei Italienern in Südtirol Deutsch. 10 Jahre früher (Sprachbarometer 2004) waren es erst 47,7% gewesen. Ein Kompliment der italienischen Sprachgruppe und auch ein Erfolg der Autonomie: es gibt nicht viele Minderheitenregionen, in welchen die Angehörigen des Staatsvolks die Minderheitensprache vor Ort in diesem Ausmaß lernen. Das es beim Deutsch-Unterricht noch viel zu tun gibt, führt das ASTAT an anderer Stelle im Detail aus.
Etwas besorgniserregend dagegen die „Zweitsprachverteilung“ bei den Zuwanderern. Zwei von drei Ausländern leben zwar in den vom ASTAT so genannten zweisprachigen Gemeinden, aber insgesamt sprechen 62% der Ausländer – neben ihren Muttersprachen – Italienisch, nur 24,6% Deutsch. Für die Integrationschancen in einem eher deutschsprachigen Umfeld hat diese Einstellung zu den lokalen Sprachen schon eine Bedeutung.
Nun gibt es Publikationen, die schon von Südtirol als einer „zweisprachigen Region“ oder gar einem melting pot berichten. Hinsichtlich der Zwei- und Dreisprachigkeitsregeln im öffentlichen Bereich mag das schon gelten, in der konkreten Sprachbeherrschung muss man auf dem Teppich bleiben. Südtirol ist ein Land mit immer mehr Menschen, die die zweite Landessprache und weitere Sprachen immer besser beherrschen, wäre etwas realitätsnäher ausgedrückt. Und dies bestätigt der Sprachbarometer 2014. Immerhin ein Drittel der Südtiroler kann relativ gut Englisch verstehen und sprechen. Vergleichbar gute Kenntnisse in einer Drittsprache haben nur die Flamen (Französisch und Englisch) und die Niederländer (Deutsch und Englisch) sowie die Schweden. In diesem Sinn kommt Südtirol dem von der EU propagierten Spracherwerbsideal „Erstsprache+ zwei Fremdsprachen“ immer näher. Die Entwicklung ist aber nicht nur subjektiv und quantitativ zu erfassen, sondern in einer derartig beschrieben Situation der Zweisprachigkeit tritt die Qualität der Sprachbeherrschung in den Vordergrund, und auch diese analysiert der ASTAT-Sprachbarometer ausführlich. Denn wenn 45,5% der Südtiroler angeben, sich auf Englisch verständigen zu können, sind wir deshalb noch lange nicht „dreisprachig“. Auch mehr als die Hälfte der Bundesbürger spricht Englisch, ohne dass die deutsche Bevölkerung als „zweisprachig“ definiert würde. Auch die vielgepriesene Mehrsprachigkeit der Ladiner ist mit Qualitätskriterien zu betrachten. Diese mögen nämlich die beiden anderen Landessprachen gut beherrschen, aber sehr viele, anscheinend die Mehrheit kann die eigene Muttersprache nicht schreiben.
Fazit: beim Sprachenlernen sind wir an einem guten Punkt, aber von der „Mehrsprachigkeit“ noch ein gutes Stück entfernt.
SALTO, 3.10,2015
Ergebnisse vorgelegt
Autonomiekonvent legt Latte zu tiefAnderthalb Jahre hat der K33 gearbeitet. Fachleute, Verbandsvertreter, Politikerinnen und ganz normale Bürger haben Vorschläge zur Reform des Statuts von 1972 diskutiert und in fast definitiver Form auf den Tisch gelegt. Der Konsens wurde immer gesucht, nicht immer gefunden, was in der Natur der Sache liegt. Dass es gleich vier Minderheitenberichte gibt, zeugt vom internen Pluralismus in der italienischen Sprachgruppe. Überrascht hat eher die Reichweite des Hauptdokuments: Wenn das Ergebnis ein echter Qualitätssprung in der politischen Eigenständigkeit unseres Landes sein soll, kann man mit diesem Dokument nicht wirklich zufrieden sein, denn in vielen Punkten stapelt der Konvent zu tief. Bedenkt man, dass diese Vorschläge noch im Landtag und Regionalrat zerklaubt werden, bis sie der Verfassungsausschuss auf das für den Staat genehme Maß zurechtstutzt, greifen sie zu kurz. Vieles fehlt, was auch in der heutigen Verfassungsordnung durchaus Platz gehabt hätte. Hier zehn Beispiele in Kürze:
1. Die Präambel ist umfassend genug und nimmt zu Recht ganz allgemein Bezug aufs Selbstbestimmungsrecht. Doch keine Spur von einer Regelung der eventuellen Inanspruchnahme dieses Grundrechts, somit auch seltsam die Aufregung um diesen Passus. Allein das Wort, das spätestens vom Regionalrat gestrichen werden wird, war für italienischsprachige Konventmitglieder eine Provokation.
2. Institutionelle Neuregelungen hat der Konvent gar nicht diskutiert. Dabei wäre gerade die Stärkung der ethnischen Konkordanz und politischen Repräsentativität bei der Bildung der Landesregierung wichtig gewesen (auch die Möglichkeit der Direktwahl der ganzen Exekutive).
3. Der Konvent konnte sich nicht zur Abschaffung der Region durchringen, vielmehr bleibt sein Vorschlag zweideutig, es wird also keine “Autonome Region Südtirol” vorgeschlagen. So fehlt das klare Signal Richtung Trient, dass Südtirol die Region loswerden will; damit wird es wohl beim Status Quo bleiben, weil die Trentiner die Region stärken wollen. Minus und Plus ergibt unter dem Strich Null.
4. Im Bereich der internationalen Beziehungen und jener zur EU ordnet man sich grundsätzlich dem Unionsrecht unter. Lösungen wie auf den Aland-Inseln, die autonomen Regionen mehr Spielraum bieten, wurden vermutlich unter dem Gewicht der Experten nicht diskutiert. Auch weniger weit reichende Vorschläge fehlen: die Klagebefugnis des Landes vor dem EuGH, eigenständige Beziehungen zu den EU-Institutionen, eine Staat-Land-Kommission für alle EU-Maßnahmen, die die Autonomie berühren, das Recht auf Beteiligung an internationalen Organisationen, Auslandsvertretungen des Landes.
5. Zumindest beim Regierungskommissariat zeigt der Konvent Flagge: es soll abgeschafft werden und das bringt zudem noch eine finanzielle Einsparung.
6. Jede Gerichtsbehörde soll unabhängig von Trient sein, schlägt der Konvent vor, aber nicht eindeutig und beschränkt sich aufs Verwaltungsgericht. Aus praktischen und finanziellen Gründen wird sich hier das Trentino durchsetzen, weil eben die regionale Ebene bestehen bleibt, die für die Organisation von staatlichen Einrichtungen genutzt wird. Eine Vorab-Kontrolle der Landesgesetze durch das Verfassungsgericht wird vorgeschlagen, was der Aufgabe der autonomen Entscheidungsfreiheit des Landesgesetzgebers gleichkäme.
7. Bei Statutsänderungen plädiert der Konvent für die Festschreibung des Einvernehmens zwischen Rom und Bozen, was in der gescheiterten Verfassungsreform vorgesehen war. Er vergisst aber, diesen Vorgang zu demokratisieren, also per Statut auch den Landtag einzubeziehen, und für Südtirol ein echtes Initiativrecht für Statutsreformen zu fordern. Keine Rede von Statutshoheit.
8. Bei den paritätischen Kommissionen drängt der Konvent nicht auf eine stärkere Transparenz, und demokratische Repräsentativität. Er bekräftigt die “paritätische Natur” der 6er- und 12er-Kommission, belässt es bei der heutigen Zusammensetzung und Verfahrensweise, wodurch dies ein Monopol der Regierungsparteien bleibt.
9. Auch bei der Regierungsform sind die Vorschläge des Konvents enttäuschend. Die nötige Erweiterung der direkten Bürgerbeteiligung (Einführung von Initiative und Referendum auf alle Landesgesetze) fehlt, Mitbestimmungsrechte der Bürger, Vetorechte des Landtags bei den Statutsänderungen fehlen. Hier hat sich wohl der SVP-PD-Flügel des Konvents durchgesetzt.
10. Bei Proporz und Schulpolitik will der Konvent alles beim Alten lassen, sicher zwei der stark kontroversen Themen. Hier kann freilich überraschen, dass die italienischsprachigen Konventmitglieder, die sich in den Minderheitenberichten fast alle für eine zweisprachige Schule aussprechen, nicht als Ersatz dafür mehr Autonomie der Sprachgruppen in der Schulpolitik fordern. Dies würde den Weg für mehr L2 und L3 an den italienischen Schulen ebnen.
Abgesehen von weiteren Reformvorschlägen wird schließlich die Liste der autonomen Zuständigkeiten aufgeführt, mit den Grenzen, die der Staat dem autonomen Gesetzgeber auferlegt, ein Herzstück jeder Territorialautonomie. Hier soll das Land all seine bisherigen Zuständigkeiten und jene der Region als primäre Kompetenz übernehmen, unter bloßer Beachtung der Verfassung (also ohne Ausrichtung und Koordinierung durch den Staat). Dazu kommen die Justizverwaltung, eine Landespolizei, Postdienste, das Landes-Olympia-Komitee. Das wäre die halbe Miete, doch auch hier haben einige Bremser im Konvent nicht zugestimmt.
Insgesamt scheint sich der Konvent zu eng an jenen undefinierten Grenzen des “Machbaren” und Durchsetzbaren orientiert zu haben. Sieht man das Statut von 1972 als großen Sprung nach vorne gegenüber 1948, wird das 3. Statut von 2018 (?) nach all den zu erwartenden Abstrichen kein solcher Sprung werden, weil schon die Messlatte zu tief liegt.
BBD_9 2017
Autonomiekonvent legt Latte zu tief
Anderthalb Jahre hat der K33 gearbeitet. Fachleute, Verbandsvertreter, Politikerinnen und ganz normale Bürger haben Vorschläge zur Reform des Statuts von 1972 diskutiert und in fast definitiver Form auf den Tisch gelegt. Der Konsens wurde immer gesucht, nicht immer gefunden, was in der Natur der Sache liegt. Dass es gleich vier Minderheitenberichte gibt, zeugt vom internen Pluralismus in der italienischen Sprachgruppe. Überrascht hat eher die Reichweite des Hauptdokuments: wenn das Ergebnis ein echter Qualitätssprung in der politischen Eigenständigkeit unseres Landes sein soll, kann man mit diesem Dokument nicht wirklich zufrieden sein, denn in vielen Punkten stapelt der Konvent zu tief. Bedenkt man, dass diese Vorschläge noch im Landtag und Regionalrat zerklaubt werden, bis sie der Verfassungsausschuss auf das für den Staat genehme Maß zurechtstutzt, greifen sie zu kurz. Vieles fehlt, was auch in der heutigen Verfassungsordnung durchaus Platz gehabt hätte. Hier zehn Beispiele in Kürze:1. Die Präambel ist umfassend genug und nimmt zu Recht ganz allgemein Bezug aufs Selbstbestimmungsrecht. Doch keine Spur von einer Regelung der eventuellen Inanspruchnahme dieses Grundrechts, somit auch seltsam die Aufregung um diesen Passus. Allein das Wort, das spätestens vom Regionalrat gestrichen werden wird, war für italienischsprachige Konventsmitglieder eine Provokation.
2. Institutionelle Neuregelungen hat der Konvent gar nicht diskutiert. Dabei wäre gerade die Stärkung der ethnischen Konkordanz und politischen Repräsentativität bei der Bildung der Landesregierung wichtig gewesen (auch die Möglichkeit der Direktwahl der ganzen Exekutive).
3. Der Konvent konnte sich nicht zur Abschaffung der Region durchringen, vielmehr bleibt sein Vorschlag zweideutig, es wird also keine „Autonome Region Südtirol“ vorgeschlagen. So fehlt das klare Signal Richtung Trient, dass Südtirol die Region los werden will, damit wird es wohl beim Status Quo bleiben, weil die Trentiner die Region stärken wollen. Minus und Plus ergibt unter dem Strich Null.
4. Im Bereich der internationalen Beziehungen und jener zur EU ordnet man sich grundsätzlich dem Unionsrecht unter. Lösungen wie auf den Aland-Inseln, die autonomen Regionen mehr Spielraum bieten, wurden vermutlich unter dem Gewicht der Experten nicht diskutiert. Auch weniger weit reichende Vorschläge fehlen: die Klagebefugnis des Landes vor dem EuGH, eigenständige Beziehungen zu den EU-Institutionen, eine Staat-Land-Kommission für alle EU-Maßnahmen, die die Autonomie berühren, das Recht auf Beteiligung an internationalen Organisationen, Auslandsvertretungen des Landes.
5. Zumindest beim Regierungskommissariat zeigt der Konvent Flagge: es soll abgeschafft werden und das bringt zudem noch eine finanzielle Einsparung.
6. Jede Gerichtsbehörde soll unabhängig von Trient sein, schlägt der Konvent vor, aber nicht eindeutig und beschränkt sich aufs Verwaltungsgericht. Aus praktischen und finanziellen Gründen wird sich hier das Trentino durchsetzen, weil eben die regionale Ebene bestehen bleibt, die für die Organisation von staatlichen Einrichtungen genutzt wird. Eine Vorab-Kontrolle der Landesgesetze durch das Verfassungsgericht wird vorgeschlagen, was der Aufgabe der autonomen Entscheidungsfreiheit des Landesgesetzgebers gleichkäme.
7. Bei Statutsänderungen plädiert der Konvent für die Festschreibung des Einvernehmens zwischen Rom und Bozen, was in der gescheiterten Verfassungsreform vorgesehen war. Er vergisst aber, diesen Vorgang zu demokratisieren, also per Statut auch den Landtag einzubeziehen, und für Südtirol ein echtes Initiativrecht für Statutsreformen zu fordern. Keine Rede von Statutshoheit.
8. Bei den paritätischen Kommissionen drängt der Konvent nicht auf eine stärkere Transparenz, und demokratische Repräsentativität. Er bekräftigt die „paritätische Natur“ der 6er- und 12er-Kommission, belässt es bei der heutigen Zusammensetzung und Verfahrensweise, wodurch dies ein Monopol der Regierungsparteien bleibt.
9. Auch bei der Regierungsform sind die Vorschläge des Konvents enttäuschend. Die nötige Erweiterung der direkten Bürgerbeteiligung (Einführung von Initiative und Referendum auf alle Landesgesetze) fehlt, Mitbestimmungsrechte der Bürger, Vetorechte des Landtags bei den Statutsänderungen fehlen. Hier hat sich wohl der SVP-PD-Flügel des Konvents durchgesetzt.
10. Bei Proporz und Schulpolitik will der Konvent alles beim Alten lassen, sicher zwei der stark kontroversen Themen. Hier kann freilich überraschen, dass die italienischsprachigen Konventsmitglieder, die sich in den Minderheitenberichten fast alle für eine zweisprachige Schule aussprechen, nicht als Ersatz dafür mehr Autonomie der Sprachgruppen in der Schulpolitik fordern. Dies würde den Weg für mehr L2 und L3 an den italienischen Schulen ebnen.
Abgesehen von weiteren Reformvorschlägen wird schließlich die Liste der autonomen Zuständigkeiten aufgeführt, mit den Grenzen, die der Staat dem autonomen Gesetzgeber auferlegt, ein Herzstück jeder Territorialautonomie. Hier soll das Land all seine bisherigen Zuständigkeiten und jene der Region als primäre Kompetenz übernehmen, unter bloßer Beachtung der Verfassung (also ohne Ausrichtung- und Koordinierung durch den Staat). Dazu kommen die Justizverwaltung, eine Landespolizei, Postdienste, das Landes-Olympia-Komitee. Das wäre die halbe Miete, doch auch hier haben einige Bremser im Konvent nicht zugestimmt.
Insgesamt scheint sich der Konvent zu eng an jenen undefinierten Grenzen des „Machbaren“ und Durchsetzbaren orientiert zu haben. Sieht man das Statut von 1972 als großen Sprung nach vorne gegenüber 1948, wird das 3. Statut von 2018 (?) nach all den zu erwartenden Abstrichen kein solcher Sprung werden, weil schon die Messlatte zu tief liegt.
BBD, 5.7.2017
Eine erste Einschätzung
Autonomiekonvent: das Forum der 100 hat gesprochenLetzten Freitag Bühne frei für das Forum der 100 des Autonomiekonvents. In Anwesenheit von gut der Hälfte der Forumsmitglieder wurde über die Arbeit der zufallsgewählten Vertretung der Normalbürger in diesem Beteiligungsverfahren berichtet. Das ausgiebige Enddokument ist aber kein Produkt des Forums selbst, sondern von acht getrennt abgehaltenen Arbeitsgruppen. Damit ist schon eine der Schwächen der Methode dieser Art von Bürgerbeteiligung benannt. Dieses Forum hat in 14 Monaten nicht die Zeit gefunden, im Plenum ein gemeinschaftliches Enddokument zu diskutieren und zu verabschieden. Das wäre wiederum dem im Landesgesetz zum Autonomiekonvent festgeschriebenen „Konsensprinzip“ zuwidergelaufen, das angeblich keine Abstimmungen zulässt. So stehen nicht nur die Einzelergebnisse der acht Gruppen widersprüchlich und ohne Gewichtung nebeneinander, sondern einige Gruppen haben gleich mehrere Vorschläge für ihren Themenbereich formuliert. Wer die Mehrheit, wer die Minderheit vertritt, wird nicht gesagt. Die Aussagen der Arbeitsgruppen überschneiden sich zudem, weil auch inhaltlich kein Abgleich durchgeführt wurde.
So gleicht das ganze Papier eher dem Protokoll eines kollektiven brainstormings, der Mitschrift eines unverbindlichen Bürgerdialogs, als einem Vorschlag für die Reform des Statuts mit entsprechender Begründung. Es erinnert an das „mit Konsensprinzip“ erzielte Ergebnis des Bürgerdialogs zur Reform des Direkte-Demokratie-Gesetzes 2014/15: eine Vielzahl von Aussagen, sehr oft nicht das Statut betreffend, ungewichtet, manchmal in sich widersprüchlich. Weder der K33 noch der Landtag können daraus eine klare Empfehlung entnehmen. Zudem gibt es auch einen zeitlichen Haken: da der K33 seine Meinungsbildung schon fast abgeschlossen hat, können auch die Delegierten des Forums der 100 im Konvent diesen keinen klaren Auftrag aus dem Dokument in den Konvent einbringen.
Nicht zuletzt wird die Arbeit des Forums der 100 genauso wie jene des Konvents der 33 durch die konkret betriebene Autonomiepolitik unterlaufen und damit zu einem gewissen Grad entwertet. Wenn in derselben Woche die Statutsabänderungen zu den Ladinerrechten vom Parlament verabschiedet werden, sind Konventsvorschläge zu diesem Thema nur mehr Papier. Konsequenterweise reagiert eine der Arbeitsgruppen zur Toponomastik des Forums der 100 nur mehr auf die gescheiterten Palermo-Durchführungsbestimmungen zu diesem Thema: auch nicht der Sinn eines Konvents.
Für die Katz war der hohe Aufwand der 100 Forumsmitglieder doch nicht, denn immerhin haben sich hier hundert Südtiroler ein Jahr lang ernsthaft und vertieft mit der Autonomiereform auseinandergesetzt, einige Arbeitsgruppen sind sogar wesentlich weitergegangen und haben ausführliche Vorschläge für die Landespolitik geliefert. So hat etwa die Arbeitsgruppe 6 zu „Soziales, Gesundheitswesen und Sport“ ein umfassendes politisches Programm erstellt, das beim „Grundrecht auf ein existenzwürdiges Leben“ (sic) beginnt und bei der Wiederherstellung der Diözesangrenzen von 1964 endet. Dazwischen breitet diese AG ein weitreichendes sozialpolitisches Regierungsprogramm aus, wovon man auch angetan sein kann. Nur: was hat es mit dem Autonomiestatut zu tun?
Andere Gruppen wollen eine lange Reihe von bürgerlichen und sozialen Grundrechten einführen und definieren das Autonomiestatut in wohlklingenden Präambeln in eine „Landesverfassung“ um. Wiederum ein Missverständnis ihrer eigenen Aufgabe: Grundrechte einzuführen, die entweder schon in der Staatsverfassung bestehen oder vor keinem Landesverfassungsgericht eingeklagt werden können, ist rechtlich nicht sinnvoll. Die Experten des K33 hätten das klären können, was anscheinend nicht geschehen ist. So gehen viele interessante Vorschläge zum Statut in einem Wust von Forderungen zur Landespolitik oder Politik in staatlicher Kompetenz unter. Manche der Visionen könnten überhaupt nur in einem unabhängigen Staat umgesetzt werden. Sogar die Arbeitsgruppe „Selbstbestimmung“ vergisst zum Ende ihrer Ausführungen, irgendeine Bestimmung zum Selbstbestimmungsrecht ins Statut einzuführen, also überhaupt die Forderung nach einer formalen Berücksichtigung dieses Rechts im Statut zu erheben.
Das mag ein anregender Dialog zwischen politisch Interessierten gewesen sein, doch in Sachen Statutsreform – der eigentlichen Kernaufgabe der ganzen Veranstaltung – ist zu stark am Thema vorbeigeschrieben worden. Damit macht man es sowohl dem K33 als auch dem Landtag leicht, dieses „Enddokument“ außen vor zu lassen: es ist in der heutigen Rechtsordnung zum Großteil ganz einfach nicht Gegenstand des Autonomiestatuts.
BBD, 15.5.2017
Gerichtsverwaltung zum Land
Autonomie bei Gerichtsverwaltung noch unvollständigDie gestern verabschiedete Durchführungsbestimmung zum Übergang der Verwaltung des Landesgerichts einschließlich des Personals ist ein wichtiger Schritt der Vervollständigung der Autonomie. Zum ersten Mal wird im traditionell sehr zentralistischen aufgebauten Justizsystem Italiens ein wichtiger Teilbereich zwei autonomen Provinzen übertragen. Zwar bleiben die Richter und Staatsanwälte ausschließlich dem Justizministerium zugeordnet, doch das Personal wird künftig von Bozen und Trient verwaltet. Wie einst beim Schulpersonal musste auch dieser Übergang gegen den heftigen Widerstand der Gewerkschaftsvertretung der Gerichtsbediensteten durchgesetzt werden. Dabei muss die Beamtenschaft gar nicht befürchten versetzt zu werden, im Gegenteil: das Land kann das Personal jetzt aufstocken und rationeller organisieren.
Nun bietet sich die Chance, die Verwaltung der Gerichtsbarkeit in Südtirol zu modernisieren. Wie in ganz Italien sind auch hierzulande die Gerichte personell unterbesetzt. Seit über 13 Jahren ist die Hälfte der Planstellen unbesetzt, weil aus Spargründen keine Sonderwettbewerbe ausgeschrieben werden. Wenn es an qualifiziertem Personal fehlt, wird auch die weit höher bezahlte Richterarbeit ineffizient. Mit mehr Personal können sich auch die Richter stärker spezialisieren, die Verfahren können schneller ablaufen, der ganze Betrieb kann bürgerfreundlicher gestaltet werden, nicht zuletzt durch eine verbesserte Zweisprachigkeit.
Was allerdings in Südtirols Autonomiesystem noch fehlt, ist ein eigenes Oberlandesgericht, m.a.W. die Eigenständigkeit unserer Justizverwaltung. Dabei geht es nicht darum, die gesamte Gerichtsbarkeit zur autonomen Zuständigkeit zu erklären. Vielmehr geht es darum, dem Land Südtirol aufgrund seiner Besonderheiten ein eigenes Oberlandesgericht zuzuerkennen. Derzeit gibt es in Bozen nur eine Sektion des Oberlandesgerichts Trient, das derzeit sogar massiv ausgebaut wird. Deshalb sind alle anderen Gerichte auf dem Gebiet der Region bisher verwaltungsmäßig an dieses OLG Trient angekoppelt. Sowohl die Provinz Trient wie das dortige Oberlandesgericht selbst, verwehren sich strikt gegen das Ansinnen, Südtirol ein eigenes OLG zu verleihen. Hier konnte sich Trient wie so fot durchset7zen. Somit ist die Autonomie in der Gerichtsverwaltung trotz diesem wichtigen Erfolg Südtirols noch unvollständig.
BBD, 31.12.2016
Was bringt der Mehrsprachigkeitshype?
Viel Stimmung wird derzeit für eine zweisprachige Schule gemacht, und zwar als zusätzliches Angebot zum dreigeteilten Schulsystem. Es wird spekuliert, ob zu diesem Zweck der Art. 19 des Autonomiestatuts abgeändert werden muss oder ob seine „Neuinterpretation“ dafür reichen würde, wie es bei der soeben blockierten DFB der Fall gewesen wäre. In diesem Sinn argumentieren auch die GRÜNEN, die vor einem Jahr einen Gesetzentwurf Nr.67/15 „Recht auf Mehrsprachlichkeit im Bildungssystem des Landes“ mehrsprachige Klassenzüge in bestehenden muttersprachlichen Schulen einführen wollten, wenn einige Eltern das wünschen. In dieselbe Richtung zielt der kürzlich von Senator Palermo vorgelegte Vorschlag für zweisprachige Klassen oder Schulabteilungen in den bestehenden Schulen. Statt den Art. 19 derart überzustrapazieren, wäre es rechtlich schon korrekter, zunächst die übergeordnete Norm abzuändern, sofern sich demokratische Mehrheiten dafür finden. Würde der Südtiroler Gesetzgeber dies von sich aus einführen, wäre nämlich auch mit Klagen auf Statutsverletzung zu rechnen.Mehrsprachigkeit ist für viele Südtiroler das Leitmotiv für die Bildung ihrer Kinder geworden, so als wäre es das absolute Oberziel der Schulbildung schlechthin, der Schlüssel fürs Leben und den beruflichen Erfolg. In diesem Sinn ist in der Bozner Pascoli-Oberschule ein dreisprachiger Schulversuch im Gang mit Deutsch, Italienisch und Englisch als Unterrichtssprachen. Es hat den Anschein, dass bei der italienischen Sprachgruppe heute das Pendel ins andere Extrem ausschlägt, nachdem die erste Generation, die mit dem Autonomiestatut aufgewachsen ist, die zweite Landessprache leider vernachlässigt hat. Wenn das die Motivation zum Deutschlernen stärkt (laut KOLIPSI waren 2014 gut 75% der italienischsprachigen Oberschüler erst auf Niveau B1 bei der deutschen Sprache), ist das nur zu begrüßen. Doch muss es in Südtirol aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit zweisprachige Schulen für alle geben?
So argumentiert Sprachwissenschaftler Siegfried Baur in der FF 11/2017 und plädiert für ein dreisprachiges Triennium vor der Matura: „Da müsste die erste Sprache allen Anfechtungen standhalten und die Jugendlichen wären international konkurrenzfähig.“ Müssen Südtirols Schüler aus einem wirtschaftlichen Grund (Konkurrenzfähigkeit) auf eine muttersprachliche Schule verzichten, die die allermeisten europäischen Altersgenossen in Anspruch nehmen? Solange nicht der gesamte deutsch- und italienischsprachige Raum von Flensburg bis Catania ein dreisprachiges Schulsystem einführt, brauchen sich Südtirols Schüler eigentlich keine Sorgen um ihre Konkurrenzfähigkeit in der EU zu machen, geschweige denn in Südtirol. Etwas CLIL, moderne Sprachendidaktik und Zusatzangebote, damit schaffen sie L2 und L3 locker. Etwas mehr Selbstbewusstsein wäre angesagt,
Die Bildungswelt Europas sieht anders aus. In Europa ist es immer noch die einsprachige Schule mit 1-2 weiteren Sprachen absoluter Standard. Millionen europäischer Abiturienten erreichen Jahr für Jahr ein Niveau in einer Zweitsprache, das ihnen ein Hochschulstudium in dieser Sprache erlaubt. In Südtirol liegen mehr als die Hälfte der deutschsprachigen Oberschüler auf B2-Niveau der Zweitsprache (KOLIPSI 2014), über 70% der Deutschsprachigen beherrschen fließend Italienisch (ASTAT). Gibt es ein Unternehmen, das Südtirol wegen mangelnder Zweisprachigkeit der Mitarbeiter wieder verlassen hat?
Ganz ohne Zweifel ist Mehrsprachigkeit im heutigen Europa ein wichtiges Bildungsziel (vgl. Barcelona-Erklärung des EU-Rats 2002: Muttersprache+2) und die Beherrschung der zweiten Landessprache ist zu Recht ein hoher Wert in der Südtiroler Gesellschaft. Doch weder hat die EU damit den 27 Mitgliedsländern aufgetragen, ihr Schulsystem in ein zwei- oder mehrsprachiges Schulsystem umzubauen, noch ist davon abzuleiten, dass Sprachminderheiten zwecks Konkurrenzfähigkeit auf Staats- und Unionsebene – also aus wirtschaftlichen Gründen – von muttersprachlichen Schulen abzugehen haben.
Dazu nochmals ein knapper Einschub aus einem Land, das von Mehrsprachigkeit etwas versteht, die Schweiz, die seit jeher den Erwerb der anderen Landessprachen in den Schulen groß schreibt (vgl. diese Analyse). In der ganzen Schweiz gibt es nicht mehr als zwei zweisprachige öffentliche Schulen, und zwar zwei englisch-deutsche Gymnasien in Zürich, die vor allem von Kindern von Business-Nomaden und gut gestellten Ausländern besucht werden. Die Einführung von zweisprachigen Oberschulen ist nicht einmal im Tessin ein Thema, das wohl am meisten befürchten müsste, auf Bundesebene sprachlich abgehängt zu werden, aber auch nicht in den zweisprachigen Kantonen (eine zweisprachige Unterstufe gibt es allenfalls für die Romanen in Graubünden).
Somit könnten auch einige Missverständnisse vorliegen, die den heutigen Hype für mehrsprachige Schulen befeuern, wie etwa folgende:
• das Missverständnis, dass die gute Kenntnis weiterer Sprachen nur über gemischte Schulen zu erreichen ist (das Standardschulmodell Europas beweist das Gegenteil);
• das Missverständnis, dass die italienische und deutsche Sprachgruppe in Südtirol beim Sprachenerwerb denselben Bedarf haben;
• das Missverständnis, dass es nur mit einer zweisprachigen Schule gelingt, gut Italienisch oder Deutsch zu lernen;
• das Missverständnis, das Sprachenlernen das Ein und Alles für Wettbewerbsfähigkeit sei (wäre dem so, wären Exportnationen wie die Schweiz, Deutschland und die Niederlande längst abgehängt);
• das Missverständnis, dass ein öffentliches Bildungssystem auf den Geschmack eines kleinen Teils der Eltern mit besonderen Wünschen zugeschnitten werden muss (Schule á la carte).
• das Missverständnis, dass gerade eine Sprachminderheit aus Konkurrenzgründen eine gut funktionierende muttersprachliche Schule aufgeben solle.
Bei letzterem würden die Befürworter der zweisprachigen Schule einwenden, dass es ihnen um einen zusätzlichen zweisprachigen Klassenzug oder ein Zusatzangebot einer zweisprachigen Schule geht, doch Simon Constantini hat schon mehrfach (vgl. Gastbeitrag in „Mehr Eigenständigkeit wagen“, POLITiS 2016) treffend aufgezeigt, wohin diese Art von Konkurrenz bei den Schulmodellen unweigerlich führen würde. Fazit: etwas mehr Bewusstsein unserer Rechte und Fähigkeiten wäre angesagt. Warum sollten gerade die Südtiroler aus Gründen wirtschaftlicher Konkurrenz die muttersprachliche Schule einschränken, wenn das weder die übrige EU und nicht mal die mehrsprachige Schweiz tut?
BBD, 21.3.2017
Moutier wechselt Kanton – Und Souramont?
Am vergangenen Sonntag ist in der Schweiz ein lang andauernder territorialer Konflikt per Volksabstimmung gelöst worden. In der Gemeinde Moutier (7.700 Einwohner, Kanton Bern) stimmten 51,7% für die Abtrennung ihrer Gemeinde vom Kanton Bern und die Angliederung an den Kanton Jura. Damit wurde auf demokratischem Weg der Schlussstrich unter ein jahrzehntelanges politisches Tauziehen gezogen. Der französischsprachige Kanton Jura war nach heftigen, aber unblutigen Konflikten erst 1978 über eine Volksabstimmung geschaffen worden. Einige französischsprachige Gemeinden hatten sich damals zunächst für den Verbleib im Kanton Bern entschieden. 1989 und 2013 stimmten dann weitere Teile des Berner Jura über einen Wechsel zum Kanton Jura ab. In Moutier war die Frage besonders umstritten. Am 18. Juni 2017 hat dort zum fünften Mal und zwar definitiv das Volk entschieden. Nur mehr zwei kleine Ortschaften müssen heuer noch abstimmen, womit der Jura-Konflikt dann auch formell beendet sein wird.So werden in der Schweiz territoriale Konflikte auf direktdemokratischem Weg ganz friedlich gelöst, während es in Italien aussichtslos erscheint, einen ganz eindeutigen Volksentscheid dreier Grenzgemeinden zu respektieren. So geschehen vor genau 10 Jahren, als sich 78% der Gemeinden La Pli, Col und Anpezo für die Rückgliederung zu Südtirol aussprachen. Die Minderheitenrechte werden n Venetien extrem vernachlässigt, in Südtirol könnten die Rechte der ladinischen Minderheit weit besser gewahrt werden. Eine ladinische Bezirksgemeinschaft innerhalb Südtirols, eine ladinische Kulturgemeinschaft innerhalb der Region gegründet werden.
Sowohl der Regionalrat Venetien als auch Luis Durnwalder hatten seinerzeit diesem demokratischen Wunsch der Buchensteiner schon zugestimmt. Im Unterschied zu weiteren 11 Gemeinden Venetiens, die sich für eine Angliederung an Trentino-Südtirol ausgesprochen haben, haben diese drei Gemeinden vor allem historisch-kulturelle Gründe für diesen Schritt geltend gemacht. Immerhin hat am 25.2.2013 selbst der Regionalrat von Venetien den Weg frei gegeben, damit das Parlament die gewünschte Angliederung gemäß Art. 132 der Verfassung umsetzen kann. Doch in der gesamten Legislaturperiode ist diesbezüglich nichts geschehen, seit 10 Jahren missachtet Rom den demokratischen Willen der Bevölkerung von Souramont.
BBD, 21.6.2017
Versprengte Piraten
Seit Mittwoch gibt es sie offiziell: die Piratenpartei Südtirols. Um sich einen sozialrebellischen Anstrich zu geben, hätte der Parteimitbegründer nicht unbedingt auf einen englischen Piraten des 12. Jahrhunderts zurückgreifen müssen, der den "reichen Fettsäcken an die Gurgel will". Da läge der Michael Gaismair schon etwas näher, vielleicht mit einer inhaltlich runderneuerten "Tiroler Landesordnung". Überhaupt scheinen Piraten in unserer Gebirgsgegend etwas deplaziert, Wilderer wären glaubwürdiger, die tatsächlich oft aus sozialer Not heraus handelten.Doch frischen Wind in die Parteienszene bringen die Piraten allemal, auch wenn ihre politische Positionierung "nicht links noch rechts, weder oben noch unten, weder hinten noch vorne" ein Uraltspruch der Grünen ist. Eine neue Partei zu gründen, heißt sich politischer Bewusstseinsbildung zu widmen, politische Phantasie entwickeln, gemeinsam Kernthemen der Politik bearbeiten, also eine Kommunikation zu politisch relevanten Themen zu entfalten. Und die Piraten anderswo zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie einen neuen Stil entwickeln, ganz neue Kreise überhaupt für Politik interessieren, sich herkömmlichen Formen verweigern und Expertokratie verabscheuen. Das versprochene Engagement für mehr Transparenz und eine bessere direkte Demokratie ist dringend nötig.
Sich nicht inhaltlich festlegen zu wollen, kann eine neue Qualität, aber auch ein Manko bedeuten. Die neue Piraten-Basis soll die politische Wunschliste in freier Diskussion festlegen. Überhaupt könnte man nächstens eine Partei als leere Schachtel gründen: das Programm definiert man dann per Ankreuzen einer Liste mit "gefällt mir" oder "gefällt mir nicht".
Bevor sich die Piraten überhaupt richtig formiert haben, werden sie aber schon von eifrigen Journalisten und Meinungsforschern zerklaubt. Natürlich haben Letztere immer Umfragenergebnisse und gute Argumente zur Hand, doch wie kann man (geschehen am gestrigen Donnerstag, RAI Sender Bozen) eine allgemeine Meinung zu den Perspektiven der Piraten deuten, bevor es sie überhaupt gibt? Anders gefragt: welchen Sinn macht es, die Ergebnisse einer Wählerumfrage, bei der 8% "Weiß nicht" oder "andere" geantwortet haben, hinsichtlich der Piraten zu deuten, obwohl es die Piraten bei dieser Umfrage noch gar nicht gab? Welche Themen sollen die Piraten denn besetzen, wenn die qualifizierten Beobachter der Arena nur mehr einige wenige Themen als "besetzbar" vorgeben? Sind Piraten nicht von vornherein Spezialisten im Besetzen und können alle Themen besetzen, die ihnen unter den Fingern brennen?
Allerdings muss rasch festgehalten werden, dass die neue Piratenriege wirklich mutig ist, sich mit solch kargen wie den gestern vorgestellten Thesen an die Öffentlichkeit zu wagen. "Wir stehen für Transparenz, Internet, Privacy und Datenschutz und stellen eine Alternative für die Wähler dar," sagt die Vorstandsvorsitzende in der TAGESZEITUNG. Braucht es für diese Anliegen eine Partei, die zu Landtagswahlen antritt? Wenn gern Alternative, warum eigentlich? Hätten die Piraten nicht zumindest das Programm der bundesdeutschen Piraten auf die Südtiroler Erfordernisse herunterbrechen können? Wie kann man sich überhaupt als politische Kraft in diesem Land präsentieren, ohne programmatische Aussagen zu zentralen Fragen zu treffen: die Weiterentwicklung der Autonomie, die Sprachenpolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik im Zeichen dezidierten Sparens, eine Politik der Verteilungsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit für Südtiroler Verhältnisse durchdeklinieren und einige wenige mehr. Leider ist dies etwas dünne Suppe, die die Piraten da aufkochen. Auch die GRÜNEN, in deren Teich die Piraten am stärksten fischen werden, stehen für Transparenz, Datenschutz, freies Internet und direkte Demokratie. Mit anderen Worten: diese Anliegen kann ein Arbeitskreis der Grünen mindestens genauso kompetent bearbeiten, ohne den Aufwand einer neuen Parteistruktur.
Dennoch wünsche ich den Piraten viel Glück. Sie sind Ausdruck der "liquid democracy", der international durchs Netz wogenden Ideen und Bewegungen, die die Menschen inspirieren, was Neues zu wagen, Demokratie zu erfahren "learning by doing", sich nicht viel um herkömmliche Wenn und Aber zu kümmern. Eine Eigenschaft, die allerdings in Südtirols Politik immer wieder verlangt wird, ist Bodenständigkeit, auf die Besonderheiten dieses Landes Bezug nehmen zu können. Das geht den Piraten noch ab. Um die Machtverhältnisse in Südtirol tatsächlich stärker aufzurühren, bräuchte es in diesem Sinne eine sozialdemokratische Initiative, die in der hiesigen Parteienlandschaft seit 30 Jahren fehlt, und diese Lücke werden die Piraten ganz gewiss nicht schließen.
BBD, 1.9.2012
Volksbegehrensvorschlag des ANCI
Politische Bildung als eigenes SchulfachVor 28 Jahren ist Politische Bildung als eigenes Fach aus den Schulprogrammen verschwunden. Es wurde zum „transversalen Unterrichtsprinzip“ erklärt, quer durch alle Fächer ohne Note und zentrale Verantwortung. Entsprechend stark gesunken ist ihr Stellenwert im Schulprogramm. Vielleicht hat man damals angenommen, es genügten für diesen Stoff genügten einige Stunden Projektunterricht pro Jahr oder gar, dass sich jeder Staatsbürger auf seine Weise politisch bilden solle.
Nach einigen misslungenen Anläufen – z.B. bei der Gelmini-Reform von 2008-09 – hat jetzt der Verband der Gemeinden Italiens ANCI dieses Anliegen aufgegriffen und die Wiedereinführung des Fachs „educazione alla cittadinanza“ in beiden Schulstufen mit eigener Benotung verlangt. Am 20. Juli 2018 hat der ANCI einen Gesetzesvoranschlag als Volksbegehren lanciert, der nach Unterzeichnung durch 50.000 Bürgerinnen vom Parlament behandelt werden muss. Durch die Umgestaltung der Fächer Rechtskunde, Geschichte und Philosophie sollen pro Schuljahr 33 Stunden gewonnen werden, die nur der Politischen Bildung dienen. Das ist auch noch wenig, wenn man bedenkt, wie viele komplexe Politik-Themen weit mehr als eine Wochenstunde für eine etwas vertiefte Behandlung mit zeitgemäßer Didaktik erfordern. In den meisten Bundesländern Deutschlands sind dem Fach Sozialkunde oder Politische Bildung zwei Stunden gewidmet.
Im Begleitbericht zum Volksbegehren erläutert der ANCI mit Leidenschaft und Realitätssinn die Gründe für die Wiedereinführung dieses Fachs als eigenständiges Schulfach. Man könnte noch anfügen, dass es in einer Zeit, in der die Jugendlichen politische Fragen vor allem in ihren social-media-Kommunikationsblasen behandeln und die Zeitungslektüre ziemlich rar geworden ist, umso dringlicher geworden ist, politische Bildung im Schulprogramm zu verankern. So könnten nicht nur zumindest einige komplexe politische Fragen der Zeit mit fachlicher Vorbereitung und Begleitung gemeinsam regelmäßig behandelt werden, sondern auch mehr politisches Interesse geweckt werden. Um das Interesse für Politik steht es nämlich unter Südtiroler Jugendlichen gar nicht gut. Andererseits sind sie der politischen Bildung gar nicht abgeneigt. Laut ASTAT-Jugendstudie 2016 befürworten 59,4% der Jugendlichen die Einführung eines eigenen Schulfachs „Politische Bildung“ (ASTAT, Jugendstudie 2016, S.87).
Die Notwendigkeit, die politische Bildung zu stärken, hat auch der Südtiroler Landtag soeben anerkannt. Im Rahmen des neuen Landesgesetzes zur direkten Demokratie hat er die Einrichtung eines eigenen Büros für politische Bildung und Bürgerbeteiligung beschlossen (Art. 24 des L.G. 25.7.2018, schon in Kraft). Dies allein wird es noch nicht richten, zumal dieses Büro vor allem in der außerschulischen und Erwachsenenbildung tätig werden wird. Deshalb käme eine Reform im Sinne des ANCI gerade recht. Der Volksbegehrensgesetzentwurf kann noch bis zum 19.1.19 in allen Gemeindesekretariaten unterschrieben werden (sofern die entspr. Bögen aufliegen).
BBD, 7.9.2018
Neues POLITiS-Dossier 13/2017
Selbstbestimmungsrecht und VolksabstimmungenSelbstbestimmungsforderungen und Unabhängigkeitsbestrebungen haben in den vergangenen 9-10 Jahren, also seit der Unabhängigkeit des Kosovo, neuen Schwung erhalten. Auch die Ablehnung wesentlicher Teile des neuen Autonomiestatuts Kataloniens durch das spanische Verfassungsgericht 2010 war ein Treibsatz dafür. Selbstbestimmung wird in der EU auf demokratischem und rechtlich geregeltem Weg über politische Verhandlungen angestrebt, in Osteuropa teils mit militärischer Gewalt und einseitiger Sezession (z.B. Ukraine, Krim und Moldawien) und auf dem Balkan (serbisch besiedelter Norden des Kosovo). In Katalonien könnte, nach Schottland 2014, im Oktober 2017 das nächste Referendum über die Souveränität einer Region stattfinden; in Neukaledonien (Frankreich) 2018 das übernächste. Auch Schottland wird wahrscheinlich nach erfolgtem Brexit eine neue Volksabstimmung über die Unabhängigkeit abhalten wollen. Rechtlich nicht bindende Volksbefragungen über die Erweiterung der Regionalautonomie stehen am 22. Oktober 2017 in Venetien und in der Lombardei an. In weiteren Regionen ist Selbstbestimmung häufig Thema der politischen Debatte, nicht zuletzt in Südtirol.
Referenden sind die klassische Methode der politischen Legitimation einer Entscheidung über den völkerrechtlichen Status eines Gebiets in einem demokratischen System. Volksabstimmungen sind nicht nur bei Gründung eines souveränen Staates, sondern auch bei anderen Veränderungen des politischen Status sinnvoll und demokratisch geboten: so standen bei zahlreichen Abstimmungen in Teilgebieten von EU-Ländern (Frankreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Dänemark) nicht nur die Unabhängigkeit, sondern auch freie Assoziation, Autonomie, eine erweiterte Autonomie und andere Arten des politischen Status zur Wahl. Nicht immer gingen die Abstimmungen zugunsten des Ausbaus der Eigenständigkeit aus, wie etwa auf Korsika 2003, in Schottland 2014, auf Puerto Rico 2017.
Einen Überblick über solche Abstimmungen bietet das neue POLITiS-Dossier 13/2017. Dabei werden nicht die vielschichtige Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts und seine Anwendung in der konkreten Politik ausgelotet, sondern ein Überblick über die 53 seit 1994 abgehaltenen Volksabstimmungen über den politischen Status eines Gebiets geboten und einige Schlussfolgerungen gezogen.
Im zweiten Teil des Dossiers geht der Autor Thomas Benedikter auf die Anwendbarkeit des Selbstbestimmungsrechts in Italien ein, das über die Verankerung der „Unteilbarkeit der Republik“ in der Verfassung jeder Sezession oder einseitiger Änderung des Status einer Region einen Riegel vorgeschoben zu haben scheint. Welche Tendenzen sich aus diesen jüngsten Erfahrungen für Italien ableiten lassen und welche Implikationen die aktuelle Anwendung des Selbstbestimmungsrechts für Südtirol hat, darauf geht der dritte Teil III des Dossiers kurz ein. Das Dossier kann von www.politis.it frei heruntergeladen werden.
BBD, 2017
Cittadinanza regionale al posto della doppia cittadinanza
La doppia cittadinanza per i sudtirolesi ovvero l’opzione di una parte della popolazione della provincia di Bolzano di acquisire la cittadinanza austriaca senza essere residenti in Austria ora fa parte del programma del nuovo governo a Vienna. Tuttavia non c’è grande entusiasmo negli ambiti governativi né a Bolzano né a Roma e neanche da parte della nuova ministra Karin Kneissl. Sarebbero pensabili anche delle alternative.L’autopercezione dei sudtirolesi più frammentata
La cittadinanza di uno Stato conferisce diritti e doveri. Ai sudtirolesi un’altra cittadinanza, cioè quella austriaca, procurerebbe non tanti doveri, ma soprattutto diritti politici e anche qualche diritto sociale. Difficilmente i sudtirolesi vorranno “pagare” il diritto al voto in Austria con 6 mesi di servizio militare oppure con un doppia versamento di imposte. Con il diritto al voto per il Parlamento austriaco in tasca i sudtirolesi di lingua tedesca e ladina si interesserebbero ancora di meno della politica italiana che ci riguarda direttamente, e di più quella austriaca che ci riguarda molto poco. Secondo l’ASTAT solo un decimo del gruppo tedesco e ladino seguono la politica in Italia. Perciò sul piano del consumo di media e dell’interesse per la vita politica la cittadinanza sdoppiata sicuramente accentuerà la sensazione di appartenere a due mondi diversi.
Esiste già l’equiparazione dei sudtirolesi in Austria
Senza dubbi la doppia cittadinanza potrebbe rafforzare il legame dei sudtirolesi con la madrepatria austriaca, dall’altra parte anche la responsabilità dello Stato austriaco per i suoi cittadini all’estero. Però già oggi in base alla “Gleichstellungsgesetz” austriaca i sudtirolesi godono di pari diritti in vari settori. Gli studenti universitari, per esempio, in Austria non pagano le tasse universitarie previste richieste dagli stranieri. D’altra parte la nostra autonomia è garantita a livello internazionale e la funzione tutrice di Vienna non viene messa in questione da parte dell’Italia. La vera funzione tutrice oggi scaturisce dall’autonomia, che garantisce sia la protezione delle minoranze sia l’autogoverno territoriale. Un’autonomia è come un invito ai gruppi autoctoni di autogovernarsi in concordanza senza dover costruirsi una seconda gamba nazionale all’estero. Gli ungheresi della Transilvania (Romania) per esempio starebbero meglio se avessero un’autonomia e non tanto la cittadinanza ungherese (di cui effettivamente tanti dispongono). Infine, la stessa Austria non intende incorrere a nuovi obblighi finanziari verso cittadini residenti all’estero, che sono né emigrati né poveri. Dall’altra parte ci sono anche centinaia di migliaia di italiani, nati e cresciuti all’estero, che votano per il Parlamento a Roma, senza aver mai messo piede in Italia.
Più importante la cittadinanza comunitaria
In provincia di Bolzano la cittadinanza sdoppiata contribuirebbe alla differenziazione della posizione giuridica della popolazione residente. I membri delle due minoranze nazionali, i cittadini “ordinari” senza riguardo alla lingua, i cittadini di altri paesi UE, gli stranieri con permesso di soggiorno illimitato, infine quelli senza permesso di soggiorno. Per i cittadini già fortemente tutelati verrebbe dispiegato un nuovo scudo di protezione, mentre per l’integrazione dei nuovi cittadini e di italiani provenienti da altre regioni non ci sarebbe alcun incentivo. Un tale scudo protettivo nel nostro caso è meno urgente dal momento che esiste sia l’accordo di Parigi sia varie convenzioni quadro europee per le minoranze ratificate sia dall’Austria sia dall’Italia. Infine, all’interno dell’Ue si sconsigliano le doppie cittadinanze per interi gruppi di persone anche per stimolare gli immigrati a scegliere un paese e la sua cittadinanza e perché i cittadini comunitari sul piano sociale e civile hanno comunque pari diritti. La doppia cittadinanza per minoranze nazionali rende meno urgente la richiesta di autonomia. È un messaggio sbagliato agli Stati nazionali.
Un legame più forte per chi non è ancora radicato
Non c’è bisogno di una tutela aggiuntiva tramite la cittadinanza di un altro Stato, ma di legami più forti e comuni fra tutti i gruppi nei confronti della propria regione di residenza. Non si può dire che tutti gli italofoni altoatesini siano ben radicati in questa terra, e ancora di meno i nuovi immigrati degli ultimi 25 anni. Per il gruppo linguistico italiani la cittadinanza austriaca sarà né interessante né raggiungibile. Per i nuovi immigrati l’integrazione sociale e culturale in una regione con due lingue è faticosa. L’Italia complica l’acquisizione della cittadinanza e in Sudtirolo i figli degli immigrati devono imparare due lingue. È risaputo che per tante famiglie immigrate, spesso parte dei ceti più poveri, torna difficile muoversi in un ambiente straniero. Nei paesi germanofoni, tutti paesi con almeno 50 anni di immigrazione, tanti immigrati della terza generazione ancora oggi si ritrovano fra i gruppi più svantaggiati nel sistema educativo e del mercato del lavoro.
Esempio isole Aland
Perciò occorre pensare a forme di cittadinanza che promuovano l’integrazione di chi oggi già vive in questa regione autonoma. Sulle isole Aland, regione autonoma della Finlandia, già esiste una tale “cittadinanza regionale”, definita “Hembygdsrätt”, ovvero diritto alla Heimat. Viene riconosciuto a quei cittadini finlandesi che padroneggiano lo svedese, vantano un periodo di residenza minimo sulle isole. Questo diritto alla Heimat sulle Aland assicura il diritto ad esercitare qualunque mestiere, ad acquistare immobili e il diritto passivo e attivo di voto alle comunali e regionali. In Svizzera si distingue fra la cittadinanza statale e quella cantonale e comunale che può essere conferita anche a stranieri residenti. Ci sono decine di migliaia di cittadini italiani in Svizzera, non ancora nazionalizzati, ma riconosciuti anche quali cittadini cantonali per cui titolari del diritto al voto attivo e passivo.
Questo tipo di cittadinanza regionale non può certamente essere trasferita sic et simpliciter all’Alto Adige, benché fosse perfettamente compatibile con il diritto comunitario. Ma ciò che conta è l’approccio di fondo: si tratta di rafforzare il legame delle persone con la loro regione, si tratta di stabilizzare i movimenti migratori e di creare condizioni migliori per l’integrazione. Inoltre si tratta di promuovere il senso di responsabilità comune per la regione di residenza. Perciò una cittadinanza regionale dev’essere aperta a tutti coloro che intendono radicarsi, perfino a persone residenti non ancora cittadini italiani. Questo tipo di cittadinanza regionale sarebbe legata ad un periodo minimo di residenza e alla conoscenza delle lingue locali. Come contropartita dovranno esserci anche alcuni diritti forti: l’accesso a tutte le prestazioni sociali degli enti locali, l’accesso al nucleo del pubblico impiego finora riservato ai cittadini, il diritto al voto nelle elezioni comunali e provinciali. Tutto questo aiuterebbe gli immigrati ad identificarsi con la loro nuova “Heimat”, a costruirsi una prospettiva di lunga permanenza per se e per i figli. Non sarebbe decisiva la cittadinanza italiana che comunque potrà seguire dopo 10 anni di residenza. In breve: invece di aprire un altro scudo protettivo per quelle persone oggi già protette da varie norme, con una cittadinanza regionale (sudtirolese) si raggiungerebbe un doppio obiettivo: un legame comune fra i gruppi che vivono in questa terra e uno stimolo aggiuntivo per gli ultimi arrivati di integrarsi bene nella società locale.
BBD, 17.1.2018
Selbstbestimmung: ein Recht jeder regionalen Gesellschaft?
Die Tiroler Schützenzeitung hat zur Abwechslung das Thema Selbstbestimmung aufgerollt und lässt Hans Heiss und Simon Constantini zu Wort kommen. In dieser Hinsicht Abwechslung auch mal bei den Schützen. Heiss hat – so wie ihn S. Constantini zitiert – wohl recht in seiner Feststellung, dass in der italienischen Sprachgruppe keine Mehrheit für einen Prozess der Selbstbestimmung existiert. Eine Menge italienischsprachiger Mitbürger haben vor einem Jahr schon vehement dagegen protestiert, im Autonomiekonvent über Selbstbestimmung überhaupt nur zu diskutieren. Bei der deutschen Sprachgruppe ist es anders. Es gibt aber keine nach Sprachgruppen aufgeschlüsselte, repräsentative Erhebung über wahrscheinliche Mehrheitsverhältnisse. Abgesehen von solchen Prognosen ist Heiss schon recht zugeben, dass sich bei einem Referendum über die staatliche Souveränität im Unterschied zu anderen Themen verschiedene Mehrheiten in den Sprachgruppen zeigen würden. Gälte bei einer solchen Abstimmung das reine Mehrheitsprinzip, wäre neuer Konflikt zwischen den Sprachgruppen unvermeidlich. Wenn wir aus der jüngeren europäischen Geschichte lernen wollen, müsste bei einer so weitreichenden Entscheidung ein Mehrheitskonsens in allen beteiligten Gruppen vorhanden sein.Doch zwei andere Punkte sind bemerkenswert. „Befreit man die Selbstbestimmung von ihrem anachronistischen Völkerrechtsbezug“, schreibt Simon in der Schützenzeitung, „sowie der Südtiroler Anomalie, bleibt ein progressives, von ethnischer Logik losgelöstes, basisdemokratisches Recht, das man selbstbestimmten Individuen in einer Demokratie unmöglich verwehren kann. Der institutionelle Rahmen, den sich die Bevölkerung eines Gebiets gibt, ist eine demokratische Entscheidung wie jede andere.“ Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was gemeint ist, ist schon klar, dennoch ist die Aussage sehr fragwürdig. Völkerrecht ist das heutige kodifizierte internationale Recht, eigentlich ein Recht der Staaten, nicht der Völker. Kollektive Entscheidungsprozesse von Völkern und anderen internationalen Rechtssubjekten können nur auf dieser Grundlage erfolgen, sonst sind wir wieder beim Faustrecht.
Anachronistisch ist nun nicht der Bezug aufs internationale Recht, sondern gewiss viele Bestimmungen im geltenden Völkerrecht. Nicht jedoch das Selbstbestimmungsrecht, das aber in der Praxis höchst selten zur Anwendung kommt. Vor allem deshalb, weil ihm ein zweites, sakrosanktes Grundrecht des Völkerrechts entgegensteht, jenes auf territoriale Integrität. In einer Organisation von Staaten wie eben den Vereinten Nationen (nicht Völker) hat dieses Rechts allemal Vorrang.
Die zweite Crux des Selbstbestimmungsrechts liegt in der altbekannten Frage, dass das SB-Recht Völkern zuerkannt wird. Was ist ein Volk? Ist die Südtiroler Bevölkerung ein Volk? Es wird sogar dann verweigert, wo überhaupt keine Zweifel bestehen, dass es ganze Völker beanspruchen (Tibeter, Kurden, Uiguren, Palästinenser, Kaschmiri, Katalanen usw.). Jedenfalls erkennen die beiden grundlegenden Menschenrechtspakte von 1966, wie Simon weiß, das Selbstbestimmungsrecht nur Völkern zu, nicht aber frei konstituierten regionalen Gesellschaften bzw. der Bevölkerung eines x-beliebigen Territoriums. Solange z.B. die Bewohner Venetiens nicht nachweisen können, ein Volk im internationalrechtlichen Sinn zu sein, können sie kaum das Selbstbestimmungsrecht beanspruchen. Die Entscheidung über Souveränität und Staatlichkeit ist keine demokratische Entscheidung wie jede andere, wie Simon schreibt. Jeder Regionalgesellschaft ganz unabhängig von ethnischen Kriterien die freie Entscheidung über ihre staatliche Organisation und Souveränität zuzugestehen, hätte zwei gravierende Folgen: zum einen würde das Selbstbestimmungsrecht den „Völkern“ genommen und territorial begründet. In unserem Fall würden dann z.B. nicht wenige dieses Recht für Trentino-Südtirol oder für die Gemeinde Bozen einklagen. Zum anderen führte es nicht nur zur Auflösung der heutigen Staatenwelt, sondern zur Multiplikation von Staaten. Die Folgen müssen nicht unbedingt nur positive sein. Zwischen dem nationalistischen Alptraum von früher, der reinen Staatsräson von heute (Räson bestehender Staaten) und dem bloßen demokratischen Mehrheitsprinzip müssen neue Lösungen ins Blickfeld rücken.
BBD, 9.1.2017
Mehrere Kandidaten für Autonomie-Reifeprüfung
Eine Antwort an Francesco PalermoEURAC-Experte Francesco Palermo regt in der FF eine neue Diskussion über die Sprachgruppenerklärung an, die nach wie vor einem kleinen Teil der Südtiroler Gesellschaft nicht gerecht wird. Den Proporz selbst stellt Palermo nicht in Frage, vielmehr läuft sein Vorschlag in ultima ratio auf die Schaffung einer vierten Gruppe hinaus, die als solche beim Proporz berücksichtigt werden sollte. Eine vierte Gruppe widerspricht aber dem Konstruktionsprinzip der heutigen Südtirol-Autonomie, die auf dem Ausgleich zwischen den drei konstitutiven Sprachgruppen aufbaut. Wenn schon, wäre an anderen Hebeln anzusetzen.
Technisch ist mit der Abkopplung der statistischen, völlig anonymen Angabe der Sprachgruppe bei der Volkszählung 2011 von der 2001 oder später abgegebenen rechtlich bindenden Zugehörigkeitserklärung keine schlechte Lösung gefunden. Im Herbst 2011 haben 90,8% der ansässigen Personen ihre Zugehörigkeit erklärt oder sich zugeordnet, 46.426 (9,2%) nicht. Dies sind nur zum Teil Menschen, die die Erklärung aus guten Gründen verweigern, sondern auch Abwesende oder Ausländer (vgl. www.provinz.bz.it/astat). Die Zählungsergebnisse 2011 weichen für die beiden großen Gruppen kaum von jenen für 2001 ab. Das belegt zweierlei: zum einen hat über 90% der Südtiroler Bevölkerung kein Problem mit einer solchen Erklärung, zum andern bleiben die Sprachgruppen numerisch ziemlich stabil. Dabei erfasst das System nur, was es erfassen soll: eine freie Zugehörigkeitserklärung, nicht den konkreten Sprachgebrauch. Die Erforschung der sprachlichen Realität gelingt ohnehin besser mit anderen Methoden, die das ASTAT z.B. beim Sprachbarometer und auch EURAC-Studien einsetzen.
Die Zugehörigkeitserklärung ist nicht gleichzusetzen mit dem Proporz, sagt Palermo, doch sie dient immer noch der Anwendbarkeit des Proporzes auf Ressourcenverteilung und Zusammensetzung von Organen. Der Proporz muss keine tragende Säule der Autonomie sein, wenn andere Säulen den Dienst besser tun. Doch ist kaum zu bestreiten, dass er sich als Schlüssel zur Verteilung einiger öffentlicher Ressourcen bewährt hat. Den früheren Konflikt um öffentliche Stellen und Sozialwohnungen hat er weitestgehend aus der Politik entfernt und ein besseres System für diesen friedensfördernden Ausgleich ist nicht in Sicht. Für unser Land ist diese schwierige Güterabwägung immer wieder angesagt, nämlich zwischen individuellen Freiheitsrechten (also kein Gruppenzwang) und kollektivem Schutz der Sprachgruppen (z.B. durch Anwendung des Proporzes). Konstitutiv für unser spezielles Autonomiesystem sind die drei Sprachgruppen, nicht eine vierte Restkategorie. Sie sind so konstitutiv wie etwa in der Schweiz die kantonale Amtssprache. Neu-Südtirolern, gleich ob aus der übrigen EU oder neue Staatsbürger mit Migrationshintergrund, werden mit dieser "Zuordnung" nicht soziale Rechte als solche verweigert. Vielmehr wird ihnen bei der Bewerbung um eine öffentliche Stelle oder Sozialwohnung eine Erklärung abverlangt, um diesem "Autonomiekonsens" Genüge zu tun, um sozusagen das höhere Gut des interethnischen Ausgleichs zu ermöglichen. Auch ein in Zürich wohnhafter Schweizer aus italienisch-französischer Familie kann das Territorialitätsprinzip nicht aus den Angeln heben, weil in seinem Wohnsitzkanton seine Muttersprachen als Amtssprachen nicht vorgesehen sind.
Freilich könnte die Autonomie, wie viele andere, auch ohne Proporz auskommen. Ein alternatives System, das in die Südtiroler Autonomielogik passt, könnte nur an zwei Kriterien ansetzen: den Sprachkenntnissen und der Ansässigkeitsdauer. Wenn man Beweglichkeit ins System bringen will, muss man an diesen Hebeln drehen, zumal sie auch schon von staatlichen und EU-Gerichtsinstanzen beanstandet worden sind. Der heute einsprachige Wettbewerb für Stellen im öffentlichen Dienst könnte etwa durch einen zweisprachigen Wettbewerb ersetzt werden, also durch eine Prüfung der fachlichen Eignung in zwei Sprachen, vergleichbar mit dem Aufnahmeverfahren der Beamten der EU. Hat man einen Wettbewerb in zwei Sprachen zu bewältigen, kommt der fachlich geeignete und sprachlich bessere Kandidat zum Zug. Je mehr man in Südtirol die territoriale Dimension der Autonomie einschließlich der Zweisprachigkeit betont, desto eher kommt eine solche Regelung in Frage. Diese Regelung könnte den Deutschsprachigen leichter fallen, aber auch Zuwanderern mit guten Kenntnissen beider Landessprachen. Würde sie die Zustimmung der italienischen Sprachgruppe finden?
Bei den dem Proporz unterworfenen Sozialleistungen werden in Zukunft weit weniger deutsche und italienische Südtiroler um knapper werdende öffentliche Ressourcen konkurrieren, als die "Einheimischen" mit neu Zugewanderten. Bei der Freizügigkeit in Italien und der EU kommt damit immer mehr die Ansässigkeit als Kriterium ins Spiel. So wie ein Ausländer 10 Jahre legal in Italien gelebt haben muss, um Staatsbürger zu werden, muss heute ein Nicht-EU-Ausländer 5 Jahre in Südtirol seinen Wohnsitz gehabt haben, um z.B. Wohngeld oder eine WOBI-Wohnung zu beantragen. Ein Albaner hat diese Regelung mit einem Rechtsverfahren beim EUGH in Frage gestellt, doch genau hier liegt der springende Punkt. Südtirol hat einen hohen Standard sozialer Sicherheit und Versorgung aufgebaut, der in Zusammenhang mit besseren Arbeitschancen zwangsläufig auch Zuwanderungsmotiv ist. Schon heute spricht man von Migranten aus dem Norden, die sich zwecks Altersabsicherung in Südtirol niederlassen. Man könnte die Forderung nach längerer Ansässigkeitsdauer als Voraussetzung für Sozialleistungen als Versuch der Abschottung einer privilegierten Region abtun, doch zu starke Zuwanderung würde ohne Zweifel die Finanzierbarkeit dieses Standards in Frage stellen. Ein auf der Ansässigkeitsdauer gründender Filter ist jedoch mit dem Grundrecht auf Freizügigkeit in der EU nicht beliebig vereinbar. Ist man in der EU bereit auf die besonderen Bedürfnisse einiger autonomer Regionen einzugehen und Ausnahmen zuzulassen, die es im Übrigen in anderen EU-Mitgliedsländern schon gibt? Diese Frage steht zudem in engem Zusammenhang mit der gesamten finanziellen Ausstattung Südtirols, die die Regierung in Rom derzeit unter Bruch von geltenden Abkommen kürzt und in Frage stellt.
Fazit: eine bloß technische Anpassung des Volkszählungsmodus, wie von Palermo angemahnt, ist etwas wenig Stoff für eine Reifeprüfung der Südtiroler Gesellschaft und Politik. Eine vollständigere Territorialautonomie könnte durchaus auch ohne diese Art der Zählung auskommen. Aber nur sofern Südtirol bei anderen Kriterien wie z.B. bei der Gestaltung der öffentlichen Stellenwettbewerbe und der Ansässigkeitsdauer mehr Spielraum erhält. Dafür haben jedoch der Staat und die EU eine Reifeprüfung abzulegen, im Fach "Stärkung und Respekt der Territorialautonomie".
BBD, 2.6.2018
Monumento al Duce
Complimenti a Gabriele per il suo commento pacato, coerente e coraggioso sullo sfondo di tante voci di lingua italiana indignate non dal fatto che nel 2011 ci sia ancora un monumento al duce non contestualizzato, ma dal fatto che un governo di uno stato democratico consente di levare un fregio di un dittatore da un edificio pubblico. Pienamente azzeccata la sua constatazione, che una razionale analisi avrebbe consigliato di provvedere allo smantellamento del duce trionfante di Piffrader già da parecchi decenni. In una prospettiva democratica europea è piuttosto bizzarro che su un palazzo pubblico si continuasse ad inneggiare al duce. Un pò come se trovassimo oggi ancora statue di Ulbricht in giro per le città della Germania orientale o fregi di Ceausescu sui palazzi di Bucarest. Stupisce il fatto che a Bolzano i partiti democratici di allora e la stessa SVP non avessero opposto più resistenza negli anni 1950 quando l'opera fu collocata. Trasferirlo in un museo per affiancarlo con testi illustrativi elaborati congiuntamente da storici italiani e tedeschi è la soluzione più convincente. Purtroppo per arrivarci ci è voluta una coincidenza fortunata di un ministro barcollante e deputati SVP pronti per un rapido sgambetto ai partiti italiani locali, che da tempo bloccano ogni progresso sull'argomento. Il metodo quindi non avrà il consenso della maggioranza dei bolzanini di lingua italiana, ma almeno possono consolarsi che tale atto rende Bolzano meno ridicola negli occhi di ogni democratico e antifascista che visita Bolzano. Ha ragione Luca quando afferma che Bolzano diventerà né meno italiano né più tedesca, ma semplicemente migliore. Che tristezza se il carattere anche italiano di questa città fosse legato soprattutto ad un monumento voluto dal duce e da fregio che rappresenta il duce. È ora che i bolzanini di lingua italiana, ora scandalizzati da questo atto illuminato di un ministro PDL, si liberino dall'idea anacronistica che l'identità anche italiana di Bolzano debba dipendere da fregi mussoliniani.BBD, 4.2.2011
Durnwalder in Afrika
“Come sono buoni i bianchi”So heißt ein alter Film von Marco Ferreri, der die Abenteuer einiger Wohltäter aus Europa im afrikanischen Busch nachzeichnet. Das Ganze endet in einer Groteske, ganz im Gegensatz zu Durnwalders Afrikareise, zu der er eben aufgebrochen ist. Viel kann dabei nicht schief gehen, denn der Landeshauptmann besichtigt auf seinen jährlichen Projektbesuchen in Übersee immer Kleinprojekte, die schon abgeschlossen und abgerechnet sind. Inspektion kann also nicht der Zweck dieser 18.000 Euro teuren Reise sein, schon eher die Vorführung der Großzügigkeit Südtirols. Wie großzügig ist die Entwicklungszusammenarbeit (EZA) wirklich bemessen, die Durnwalder ganz persönlich bestimmt? Das lässt sich aus dem Vergleich einiger Zahlen erschließen.
1) Schließt man noch einige Beiträge für humanitäre Hilfe ein, umfasst Südtirols öffentliche EZA in den letzten Jahren ziemlich konstant 2 bis 2,5 Mio. Euro. Der Landeshaushalt stieg an, diese Ausgaben blieben gleich. Somit gibt das Land jährlich dafür weniger aus als für die Subventionierung des Flugverkehrs. Insgesamt hat das Land seit Bestehen der EZA 1992 nicht einmal den Betrag aufgewendet, den das Fahrsicherheitszentrum in der Frizzi-Au gekostet hat. Nun hat die Autonome Provinz ein Finanzierungssystem, das es gerechtfertigt erscheinen lässt, ihre EZA nach den internationalen Vergleichswerten zu messen. 2010 sollten die Industriestaaten laut den 2000 als Milleniumsziel eingegangenen Verpflichtungen 0,51% des BIP erreichen, die bis 2015 auf 0,7% des BIP gesteigert werden müssen. Italien befindet sich mit 0,11% (2008) unter den Schlusslichtern und 2009 ist sein Entwicklungshilfebudget auf 321 Mio. gekürzt worden, womit es den drittletzten Platz unter den Industrieländern einnimmt. Nimmt man Südtirol aufgrund seines Finanzierungssystems als eigenständige Einheit und berechnet den UNO-Richtwert für die Entwicklungshilfe, ergibt sich bei einem BIP von 17.000 Mio. Euro (2010 geschätzt) ein Soll-Wert der jährlichen EZA-Ausgaben von 86,7 Mio, die bis 2015 auf über 119 Mio Euro ansteigen müssten. Tatsächlich sind es aber 2,5 Millionen, die 0,014% des Südtiroler BIP entsprechen. Südtirol gibt also etwa 1/35 des UN-Richtwertes für ein reiches Industrieland aus.
2) Dabei ist unser Land laut den neuesten offiziellen Berechnungen der CPT (http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp) nicht nur wohlhabend, sondern war für viele Jahre selbst Nettoempfänger bei den öffentlichen Finanzen. Für den Gesamtzeitraum 1996-2007 weisen die CPT Südtirol als Empfänger eines Überschusssaldos bei den öffentlichen Finanzen von 200 Mio Euro im Jahresdurchschnitt aus. Immerhin an jene Provinz, die zusammen mit dem Aostatal an der Spitze der Rangordnung Italiens beim BIP pro Kopf steht. 200 Mio Euro netto an "Entwicklungs-zusammenarbeit aus Rom" - das ist auch schon etwa die Hälfte des Betrags, den Rom jährlich als Entwicklungshilfe insgesamt den ärmsten Ländern zukommen lässt. Oder anders gefasst: unser Land erhielt über all diese Jahre 200 Mio netto, gab selbst nicht mehr als 2,5 Mio netto für die EZA und humanitäre Hilfe aus. Die quantitativen Relationen der Großzügigkeit.
Haben Durnwalders Besichtigungstouren nun irgendeinen Einfluss auf seine Vorstellungen von angemessener Dotierung der EZA? Nachweislich nicht. Denn eben haben die GRÜNEN einen Gesetzentwurf im Landtag vorgelegt, um das Land zu verpflichten, 0,25% des Landeshaushalts jährlich für die EZA vorzubehalten. Eine solche Regelung hat das Trentino, das jährlich immerhin 10 Mio. Euro bereitstellt. Der LH hat diesen Vorschlag prompt vom Tisch gewischt, die SVP-Mehrheit den Gesetzentwurf geschlossen abgelehnt. Es bleibt bei den 2-2,5 Mio Euro. Die kleinen und großen Schwarzen in den Dörfern, die der gute Weiße aus Südtirol besucht, wissen davon nichts, weshalb sie wie immer beim Gruppenbild fröhlich in die Kamera lachen werden, das der Landeshauptmann für die heimischen Medien dringend braucht.
BBD, 9.2.2010
Il ruolo ambiguo
Il ruolo ambiguo della Provincia autonoma nella riscossione delle entrate tributarie e l'alternativa fattibileA fine febbraio i sindacati hanno proposto di abolire l'addizionale IRPEF regionale e comunale per consentire ai lavoratori un modesto recupero di potere d'acquisto. L'operazione verrebbe a costare 65 milioni di Euro alla Provincia autonoma, controbilanciabili con risparmi in varie categorie di spesa provinciale. Un atto dovuto della Provincia, affermano i sindacati unisono, dopo due tappe di tagli all'IRAP per sgravare gli imprenditori sono costate notevolmente di più in termini di entrate mancate. Durnwalder si è detto contrario perché una tale misura avvantaggerebbe I percettori di redditi più alti e perché la Provincia sarebbe costretta a risparmiare. Dall'altra parte, sotto pressione delle associazioni imprenditoriali, il presidente si impegna affinché siano allentati i controlli fiscali per le imprese. La Guardia delle finanze, per contro, nel corso 2008 grazie a 772 verifiche ha scoperto 770 milioni di Euro non dichiarati al fisco, recuperando 200 milioni di Euro di imposte evase. Due controlli per giorno in una provincia con 50.000 imprese non sono eccessive, ma ciò nonostante la Guardia delle Finanze ha dovuto ridurre questo numero a causa della mancanza di personale (vedi DOLOMITEN, 30.12.2008).
Infatti, per finanziare un'eventuale taglio dell'addizionale IRPEF regionale e comunale il rafforzamento della lotta contro l'evasione, „l'imposta invisibile“ (CGIL), sarebbe la fonte più abbondante, senza ricorrere a riforme fiscali. Una ricerca dell'AFI-IPL (dimensione lavoro n.1/2005) ha stimato l'economia sommersa nella nostra provincia con 18% del PIL provinciale (17 miliardi Euro nel 2008), mentre il Ministero delle Finanze arriva ad almeno il 12%. Assumendo la media come stima realistica, il gettito fiscale non incassato equivalente a tale dimensione di economia sommersa tocca quasi un 1 miliardo di euro. In altre parole: se ci fosse un impegno serio da parte di tutto l'ente pubblico contro l'evasione fiscale, sia a livello del personale, dei sistemi informatici, die regolamenti impiegati nell'accertamento e verifica delle imposte, le maggior entrate fiscali potrebbero gonfiare il bilancio provinciale. per le casse provinciali e consentire riduzioni eque e solidali della pressione fiscale per tutti. In quest'ottico appare assurdamente ambiguo e controproducente il continuo impegno della Provincia per allentare i controlli fiscali delle imprese ed in generale la sua mancanza di collaborazione per la riscossione delle imposte, benché fosse prevista dallo Statuto di autonomia (art. 11). Occorre ricordare che anche secondo il nuovo sistema di finanziamento, stipulato con il governo nel novembre 2009, di ogni euro non riscosso in imposte erariali, mancano 90 centesimi alle casse dalla Provincia, non più spendibili per i servizi sociali, per il sistema formativo ed il miglioramento delle strutture sanitarie.
Di un taglio all'IRPEF regionale e comunale approfitterebbero di più i percettori di redditi alti? Non è un buon argomento questa affermazione di Durnwalder, perché basterebbe applicare uno sgravio limitato ai redditi dei lavoratori dipendenti non eccedenti un determinato limite. Anche se i redditi alti fossero fra i beneficiari, non è questo che incide per una tassazione più equa dei redditi: occorre ricordare che nella nostra provincia, al vertice delle regioni d'Italia secondo il PIL pro capite, nel 2010 si incasserà appena 103,8 milioni di Euro di imposte sui redditi da capitale (previsioni della Provincia autonoma), e sono quasi inesistenti le entrate provenienti da imposte sugli immobili. È infondato, inoltre, il timore che il piccolo taglio dell'addizionale IRPEF necessariamente dovrà ripercuotersi sulle tariffe pubbliche: la Provincia ha ampie possibilità di risparmio in altri settori. Due esempi: con 327 mio. di Euro la Provincia nel 2010 spenderà più del doppio in contributi alle imprese rispetto il Land Tirolo, per non citare neanche il livello di contributi alle imprese delle regioni ordinarie vicine. Dall'altra parte, i politici SVP, benché tesi a sbandierare la necessità dell'autonomia impositiva (Steuerautonomie), non usano lo spazio impositivo già presente nello statuto di autonomia. L'imposta sul turismo (art. 9) è stata soppressa 15 anni fa per fare un regalo agli albergatori e le lobby imprenditoriali e perché la Provincia, in presenza di un lauto saldo fiscale primario a suo favore, non ne aveva neanche bisogno. I tempi sono un attimino cambiati.
Quale conclusione? Oggi non basta ripetere gli slogan generici contro l'evasione fiscale, benché legittimo, se ai vertici della Provincia continua a regnare l'atteggiamento di frenare i controlli fiscali invece di impegnarsi seriamente affinché venga recuperata almeno una parte die 900-1000 milioni di Euro che ogni anno non affluiscono nelle casse provinciali per questo motivo. I semplici richiami dei sindacati sono effimeri perché stante alla situazione odierna le responsabilità per la riscossione fiscale non sono per nulla appropriate. Il problema di fondo è quello che nella nostra provincia (e in tutte le altre regioni speciali) non coincidono le responsabilità di spesa pubblica da una parte e di imposizione e riscossione delle imposte dall'altra. Se l'autonomia impositiva resta un obiettivo lontano, a cui ci si avvicinerà solo con piccoli passi, mentre è molto più realistica la provincializzazione della funzione della riscossione. Un'agenzia delle entrate provinciale dovrebbe avere due caratteristiche di fondo: da una parte l'efficienza dell'amministrazione provinciale portando un altro tipo di trasparenza in questa materia; dall'altra parte l'indipendenza dagli interessi delle categorie economiche. In altre parole: dovrebbe trattarsi di un'agenzia non succuba alla Giunta provinciale orientata secondo le preferenze politiche die più forti, ma controllata da organi composti da cittadini eletti e magistrati. I vantaggi sarebbero enormi, soprattutto per contrastare l'evasione. La stretta collaborazione fra l'amministrazione provinciale e agenzia delle entrate permetterebbe di incrociare una marea di dati disposizione della Provincia sui contribuenti e percettori di un'ampia gamma di servizi e contributi locali. Tutto questo a vantaggio dell'efficienza della riscossione e del volume delle entrate spendibili da parte della Provincia per i servizi per la collettività. Tale riforma consentirebbe di raddrizzare un effetto perverso: la Provincia, benché beneficiaria del 90% delle entrate erariali, non solo non s'impegna, ma chiede un fisco possibilmente più assente.
BBD, 6.3.2010
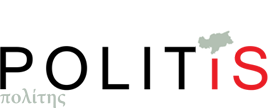
![[[Slogan]]](img/logo_slogan.png)

