Umweltpolitik
Was tun gegen die nächsten Viren?
Tofu statt SpeckIst Ihnen das Borna-Virus bekannt? Unter anderen sind Eichhörnchenzüchter und Katzenbesitzer daran verstorben, aber bisher halt nur wenige. Schon bedrohlicher war die Entdeckung einer mutierten Form des Corona-Virus in dänischen Nerzfarmen. 15 Millionen Tiere mussten kurzerhand vernichtet werden, deren Kadaver jetzt wieder exhumiert wurden, weil sie das Grundwasser verseuchen könnten. Andere Viren lauern schon, die die nächste Pandemie auslösen könnten, wie das Schweine-Corona-Virus SADS-CoV. Eine Studie des UN-Umweltprogramms hat nachgewiesen, dass es auch menschliche Zellen infizieren kann. Und damit sind wir beim Schlüsselvorgang für die laufende Pandemie, der Zoonose. Dass laufend Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden – Ebola, SARS, HIV, West-Nil-Fieber usw. – war bekannt, doch erst seit Corona ist bekannt geworden, dass gut drei Viertel aller neu beim Menschen auftauchenden Krankheitserreger zoonotisch sind.
Wenn die Zoonose derartige Folgen hat, reicht es denn bei der Vorbeugung bloß einige Wildtiermärkte in China zu schließen? Oder muss doch dort eingegriffen werden, wo die nächsten neuartigen Viren längst schon brüten? Wie in Dänemark ersichtlich ist die ideale Brutstätte der Viren die industrielle Nutztierhaltung. Der österreichische Lebensmittelwissenschaftler Kurt Schmidinger von futurefood.org nennt sechs Faktoren, die moderne Tierfabriken zu Epizentren für Pandemien werden lassen. Entgegen den Behauptungen der Tierfabriksbetreiber sind ihre Großfarmen offen und durchlässig wie ein Scheunentor. Millionen Tiere bewegen sich aus und ein, dazu Personen, Futter, Abwasser, Mist, Insekten, Abluft – alles kann die Viren nach außen tragen. In der Massentierhaltung erfolgt das genaue Gegenteil des „Abstandhaltens“. Zigtausende auf kleinstem Raum zusammengezwängte Schweine, Kälber, Hühner und Nerze bilden ideale Bedingungen für die Verbreitung. Bevor die Tiere am Virus sterben, haben sie einige hundert andere daneben angesteckt. Warum keult man sonst gleich alle 15 Millionen Nerze in Dänemark? Am Ende verlassen alle virenbelasteten Tiere die Tierfabriken. Der virenbelastete Feinstaub infiziert das Personal und dringt nach außen. Millionen Tonnen Exkremente landen auf den Feldern und infizieren andere Lebewesen. Wenn es, abgesehen von infizierten Menschen, Virenschleudern gibt, dann ist es die industrielle Massentierhaltung.
An diesem Punkt kann es schon irritieren, dass die Regierungen im Zuge der Seuchenbekämpfung Milliarden Dollar (weltweit: Billionen) in die Hand nehmen, um das Gesundheitswesen aufzurüsten, die Bevölkerung durchzuimpfen und die Wirtschaftskrise zu bewältigen, aber nichts wirklich gegen die Massentierhaltung unternehmen. In Deutschland „leben“ Millionen Schweine in Kastenständen mit 65 x 200 cm: die arme Sau kann sich nicht umdrehen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil davon verwandelt sich anschließend in Südtiroler Speck. Nun hat man ihnen mit einer Übergangszeit von 8 Jahren einige Zentimeter mehr Platz und eine kürzere Dauer des Kastenstands zugestanden. Soll das die Viren bremsen?
In Südtirol wird argumentiert, dass es hier keine Massentierhaltung gäbe. Doch importiert Südtirol 70 Millionen kg Fleisch im Jahr, wovon die Hälfte in die Speckherstellung wandert (FF Nr.27/2020). Der hohe Fleischverbrauch der Inländer, der fleischintensive Tourismus, die florierende Speckindustrie machen uns zum Teil der Geschäftskette. Dieses Niveau an Tierkonsum geht weder mit Nachhaltigkeit noch mit Klimaschutz noch mit Tierwohl und auch nicht mit dem Schutz vor gefährlichen Krankheitserregern zusammen. Dann ist es nur mehr kurios, wenn die steuerfinanzierte IDM in einem Spot Südtirol als „nachhaltigsten Lebensraum Europas“ bewirbt, und in der nächsten Anzeige den Südtiroler Qualitätsspeck preist, denn Speckproduktion im heutigen Stil geht gar nicht ohne Massentierhaltung.
Zugespitzt: es muss nicht Tofu sein, aber weniger Tierkonsum schont nicht nur Millionen von Tieren, vermeidet klimaschädliche Treibhausgase und fördert unsere Gesundheit, sondern schützt auch vor den nächsten zoonotisch übertragenen Viren. Das wäre doch ein Grund zum Handeln, oder?
Thomas Benedikter
Studie der UNEP: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/neuer-schweine-coronavirus-sads-cov-infiziert-auch-menschliche-zellen-13374229?fbclid=IwAR2o70BJDxq8RSNNR8h0xw2eXWnwYx30EHY19OhwD_-Nb4YastsoxCjEAQs
Artikel von Kurt Schmidinger auf: www.futurefood.org
SALTO, 6.12.2020
Tourismuskonzept
Bettenobergrenze ein Ablenkungsmanöver?Bettenobergrenze in Kombination mit einer „Bettenbörse“: das klingt nach echtem Umsteuern in der Tourismusentwicklung. Kann das Etikett halten, was es verspricht?
Wenn der Tourismuslandesrat einen Bettenstopp ankündigt, gar von einer Deckelung der Nächtigungszahlen spricht, ist das schon ein bedeutsamer Schritt. Dass das Land touristisch überbeansprucht ist (overtourism), scheint jetzt in der oberen Etage angekommen zu sein. Den Bettenstopp hätte LR Schuler allerdings zusammen mit einem Stopp für neue Tourismuszonen auch schon im Landesraumordnungsgesetz verankern können, und zwar gesetzlich statt mit einem bloßen Plan. Solange nun das neue Gesamtkonzept für die touristische Entwicklung nicht auf dem Tisch liegt, wäre es verfrüht, näher darauf einzugehen. Ein-zwei zentrale Aspekte lassen sich aber vorwegnehmen.
Reicht ein Bettenstopp, der die bereits genehmigten neuen Betten noch gar nicht einbezieht, als Bremse für den Übertourismus? „Beim Bettenstopp handelt es sich um ein Manöver, das von einem Etikettenschwindel nicht allzu fern ist,“ schreiben die GRÜNEN in ihrer Stellungnahme zum neuen Tourismuskonzept. Richtig, denn gerade die Kombination mit einer „Bettenbörse“ weicht das Ganze wieder auf. Eigentlich ist der dem CO2-Emissionshandel entliehene Grundgedanke einer Börse (eigentlich Kontingentierung) nicht schlecht: man deckelt die Bettenzahl irgendwo bei 240.000 und nur wenn irgendwo Betten „aufgelassen“ bzw. abgemeldet werden, dürfen neue Bettenburgen entstehen. In Südtirol geben immer mehr Betriebe im unteren Sterne-Bereich auf: warum nicht die „verlorenen“ Betten ersetzen und gleichzeitig qualitativ aufwerten, wenn dadurch die Wertschöpfung insgesamt steigt?
Doch ist die reale Entwicklung absehbar: es werden immer mehr Betten von kriselnden 2- bis 3-Sterne-Betrieben ins Hochpreissegment umverteilt, wo die Touristen mehr Geld lassen. Diese Strategie wird unter dem Motto Qualität statt Quantität verkauft und sorgt für die Zustimmung beim HGV. Was die Tourismuslobby unter Qualität versteht, ist allemal Rentabilität. Die bloße Zahl der Betten ist sekundär. Rentabler werden die Betten mit mehr Service, Ausstattung und Platz, sprich Kubatur. Waren früher 2-3 Betten ein Zimmer in einer Pension oder in einem mittelgroßen Hotels, sind heute zwei Betten Teil einer Wohnung in einer ausgedehnten Hotelanlage. Ganze Chalet-Weiler fressen sich in die Landschaft (Ratschings, Pflersch, Hafling, Seiser Alm) oder überragen als Hoteltürme unberührte Waldlandschaften (Forestis). Die touristische Überbelastung hat viele Dimensionen von der Hypermobilität (immer mehr Kurzzeitaufenthalte), energieintensivem Wellnessbereich, Flächenverbrauch für die Außenanlagen und neue Aufstiegsanlagen. Betten sind nur ein Indikator des Drucks auf Land und Leute. Noch mehr Bodenversiegelung und Beton ist nicht nur in Sachen Klimaschutz unvertretbar, sondern auch Gift für das eigentliche touristische „Kapital“ Südtirols: die Landschaft.
Fazit: Eine Bettenobergrenze reicht nicht, wenn die touristische Kubatur und Infrastruktur munter ausgebaut werden dürfen, während die ausgesonderte Hotelkubatur nicht verschwindet. Vielmehr bringt jedes neue Bett im 5-Sterne-Segment ein Vielfaches an Kubatur-, Flächen-, Energieverbrauch und Mobilität mit sich, es sei denn, die ersetzte Hotelkubatur würde saniert. Doch wo geschieht das schon?
Wenn die Verhinderung der touristischen Überbeanspruchung das Ziel wäre, müsste das Land nicht nur die Bettenzahl, sondern auch den Flächenverbrauch (Tourismuszonen) und die Hotelkubatur jeder Art deckeln. Sie müsste auf neue Erschließungsprojekte genauso wie auf die Subventionierung der gesamten Branche (einschließlich Urlaub auf dem Bauernhof) verzichten. Sie müsste mit der alljährlichen IDM-Flutung der Medien mit Standort-Werbung aufhören und für fairere Löhne im Gastgewerbe sorgen. Mehr Kostenwahrheit würde das Angebot verteuern, wodurch die Nachfrage etwas eingedämmt würde wie in der Schweiz geschehen. Eine Bettenobergrenze allein tut es nicht. Jetzt, in Zeiten der Corona-Krisenbewältigung ist das freilich nicht durchsetzbar, doch mittel- und langfristig führt kein Weg dran vorbei. „Der Tourismus muss sich selbst im Interesse der Wirtschaftlichkeit Grenzen setzen,“ meinte der Landesrat im SALTO-Interview vom 3.3.21. Neben der bloßen Wirtschaftlichkeit gäbe es halt auch noch den Landschafts- und Klimaschutz, die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung und das Gemeinwohl.
SALTO, 5.3.2021
Corona und Klimawandel
Die CO2-Steuer jetztDer Neustart der Wirtschaft nach der Pandemie wird in Europa mit Billionen Euro öffentlicher Ausgaben unterstützt. Wenn das auch dem Klimaschutz dienen soll, braucht es die CO2-Steuer jetzt.
Staatsgrenzen sind sowohl für das Virus wie für die Treibhausgase irrelevant. Beide fordern jetzt und in den nächsten Jahren gewaltige Staatsausgaben, beide treffen die ärmeren und schwächeren Gruppen der Gesellschaft härter. Auf keine von beiden hat die internationale Gemeinschaft bisher ausreichend solidarisch und koordiniert reagiert. Der globale Lockdown hat die Weltwirtschaft stärker eingebremst, als in der Finanzkrise 2008/09 geschehen, und ganz nebenbei die Emission von Treibhausgasen deutlich reduziert. Davon zeugt auch der seit drei Monaten fast kondensstreifenfreie Himmel über Südtirol. 2020 sollen laut Schätzungen 8% weniger Treibhausgase in die Luft geblasen werden als 2019. So wird Deutschland überraschenderweise seine Klimaziele für 2020 erreichen. Weltweit ist man den Paris Klimazielen noch kaum näher gekommen. Natürlich sind die Corona-bedingten Einschränkungen von Mobilität und Wirtschaft nicht der sozial verträgliche Weg dorthin. Und die jetzt notstandsbedingte und vorübergehende Reduzierung bringt auch nur 10% der gesamten Emissionsreduzierung, die für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels erforderlich ist.
Zum anderen bewegt sich der Ölpreis derzeit auf einer Talsohle, höchst kontraproduktiv für den Klimaschutz. Damit werden emissionsärmere Energieerzeugung und Energieverbrauch wieder ein Stück uninteressanter. In dieser besonderen Situation käme eine CO2-Bepreisung gerade richtig. Während verschiedene Wirtschaftsverbände angesichts der Pandemie eine Pause in der Klimaschutzpolitik verlangen, ist gerade das Gegenteil gefordert: die Einführung einer nationalen (Italien) oder besser EU-weiten Steuer auf fossile Brennstoffe. Sie würde den Preis dieser Energieträger anheben und in die Investitionen für Wiederaufbau in die erwünschte klimaverträgliche Richtung lenken. Die Investitionen in erneuerbare Energien könnten zentraler Bestandteil aller Pläne der nationalen Regierungen sein, und damit sowohl Wiederaufbau wie Energiewende beschleunigen. Alle Konjunkturpakete für die Zeit nach Corona sollten darauf ausgerichtet sein, neben der Stützung von Beschäftigung und Wirtschaft gleichzeitig auch den Green Deal und den Klimaschutz in der EU insgesamt voranzubringen. Hat nicht die EU-Kommission selbst zugesagt, beim Einsatz der Recovery Fund-Mittel die Klimaziele beachten zu wollen?
Gerade für Italien hätte die CO2-Steuer in der jetzigen Phase klare Vorteile. Die Erlöse dieser Steuer würden dazu beitragen, die gewaltige Erhöhung des Schuldenstands wieder etwas zurückzufahren. Großverbraucher fossiler Energie wie Kohle- und Ölkraftwerke, unrentable Flughäfen und Fluggesellschaften (Alitalia) und marode Stahlwerke (ILVA) müssten nicht mehr mit x Millionen an Steuergeld weitergeschleppt werden. Es wäre ein guter Moment, diese „Steuergeldsenken“ aufzugeben und öffentliche Mittel in zukunftsträchtige Kleinunternehmen und klimaverträgliche Projekte zu stecken. Die meisten Italiener würden die CO2-Steuer gar nicht bemerken, weil sie den Energiepreis nur auf Vorkrisenniveau stabilisieren würde. Italien wäre auch kein Vorreiter. Frankreich besteuert die CO2-Emissionen seit 2002, Finnland seit 1990 und Schweden seit 1991. Slowenien hat neben Estland seit 2002 die umfassendste CO2-Besteuerung der EU.
Eine CO2-Steuer ist nicht nur wirkmächtig für den Klimaschutz, sondern auch marktwirtschaftskonform. Über den Markmechanismus würden Anreize für Haushalte und Unternehmen geschaffen, die Emissionen zu vermindern. Somit ein marktgerechter Modus, energieeffiziente Produktion, Mobilität, Gebäudeheizung zu fördern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Steuer käme zum jetzigen Zeitpunkt richtig, weil erneuerbare Energien dadurch definitiv rentabel werden. Zudem ist die CO2-Steuer so einfach und kostengünstig einzuheben wie die Mineralölsteuer, nämlich direkt bei den Erzeugern und Verteilern. Andere Treibhausgase kann man über die Bemessung ihres CO2-Äquivalents in die Besteuerung miteinbeziehen.
Der jetzt von der Pandemie ausgelöste Wachstumsknick sorgt zwar für eine kurze Entlastung bei der Erderwärmung, insgesamt gesehen ist er gewiss nicht nützlich für die Bekämpfung des Klimawandels. Hunderttausende Opfer, Millionen arbeitsloser und verarmter Menschen, gewaltige soziale Krisen und dürfen keinesfalls mit positiven Nebeneffekten aufs Klima gegengerechnet werden. Doch diese Krise kann sich wiederholen und der Klimawandel wird sich langsamer, aber dauerhafter auswirken. Die Menschen sind sich jetzt der Folgen solcher Krisen stärker bewusst geworden. Deshalb eröffnet sie auch eine Chance: man kann die Latte für den Klimaschutz höher legen und das Wachstum umpolen. Und dafür bildet die Verteuerung der Treibhausgasemissionen über eine CO2-Steuer ein Schlüsselelement.
SALTO, 2.12.2020
EU-Bürgerinitiative
CO2-Emissionen besteuern und verteuernEine EBI fordert die EU-Kommission auf, ein EU-Gesetz vorzulegen, mit dem fossile Brennstoffe höher besteuert und erneuerbare Energiequellen gefördert werden, damit die Erderwärmung gestoppt und der Temperaturanstieg auf 1,5° C begrenzt wird.
Die geforderte CO2-Steuer soll aber auch für Klimagerechtigkeit sorgen. Eine ganz zentrale Schiene für mehr Klimagerechtigkeit verschiebt die Abgabenlast von den Geringverdienern auf den Verbrauch fossiler Energieträger. Der Grundgedanke ist höchst einfach. Eine quantitativ wirksame, allgemeine CO2-Steuer verteuert die Nutzung fossiler Brennstoffe und fördert damit automatisch den Umstieg auf erneuerbare Energie. Der Erlös dieser CO2-Steuer wird für die Senkung der Einkommenssteuer auf mittlere Einkommen und Niedriglohnbezieher verwendet, er reduziert auch die Lohnnebenkosten und schafft dadurch Arbeitsplätze. Durch diese Abgabenentlastung können Geringverdiener Nachteile und Lasten der CO2-Steuer etwa durch steigende Heizungs- und Mobilitätskosten wettmachen. Die Hauptlast tragen die Höherverdienenden, die ohnehin einen weit größeren CO2-Ausstoß verursachen.
Derzeit beträgt die CO2-Steuer bei den ETS (Europäisches Emissionshandelssystem) nur 20 Euro pro Tonne CO2, also viel zu wenig, um wirklich zu wirken. Außerdem sind 55% der CO2-Emissionen in der EU gar nicht in dieses System einbezogen und bleiben davon unbelastet. Verkehr und Transport, Gebäudeheizung, Klein- und Mittelbetriebe und die Landwirtschaft sind noch nicht von einer CO2-Steuer betroffen. Die vorgeschlagene CO2-Steuer bemisst sich nach dem Gehalt an Kohlenstoff des jeweiligen Energieträgers und ist relativ einfach einzuheben. Ziel der EBI ist auch eine EU-weit gleichmäßige Besteuerung der CO2-Emissionen, um die absehbare Verlagerung emissionsintensiver Industrien in ärmere Ländern mit geringerem Niveau an CO2-Besteuerung von vornherein zu verhindern.
Die Promotoren schlagen einen Mindestpreis von 50 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2020 vor, der bis 2025 auf 100 Euro angehoben werden soll. Gleichzeitig wollen sie die heute geltenden kostenlosen Emissionszertifikate für CO2-Verursacher in der EU (rund 11.000 größere Unternehmen) abschaffen und ein Ausgleichssystem für Importe aus Drittländern einführen, um die geringere Belastung des CO2-Ausstoßes in solchen Ländern zu kompensieren. Die Mehreinnahmen aus der CO2-Abgabe sollen für EU-weite Energiesparmaßnahmen und für erneuerbare Energiequellen sowie zur steuerlichen Entlastung niedriger Einkommen verwendet werden.
Erstunterzeichner dieser EBI sind Marco Cappato, früherer MEP und Gründer von „Science for Democracy“, Monica Frassoni, die frühere Fraktionsvorsitzende der Grünen im EP, Spyros Psychas, Koordinator von ANIMA Griechenland und einige Wissenschaftler aus Portugal, Rumänien, Deutschland und den Niederlanden. Hier kann diese EBI in weniger als einer Minute unterzeichnet werden. https://europa.eu/citizens-initiative/_de
SALTO, 7.2.2021
Kuriosität
Ferienwohnungsbesitzer als förderungswürdige Jungunternehmer„Qualitätsoffensive bei der COVID-Gewinnern“ betitelte die DOLOMITEN vom 25.8.2020 ganz unbefangen einen Bericht über die „Verschärfung“ der Beitragskriterien an einen besonders innovativen Erwerbszweig: die Vermieter von Ferienwohnungen, die diese ausbauen oder qualitativ verbessern wollen. Bisher konnten solche Unternehmer (private Wohnungseigentümer, oft Bäuerinnen) vom Land Beiträge für den Ausbau von Ferienwohnungen bis maximal 40.000 Euro in 5 Jahren beziehen. Man konnte auch Jahr für Jahr wiederholt für solche Beiträge ansuchen, sozusagen sich gestaffelt 1A-Ferienwohnungen aufbauen. Nun soll künftig nur mehr ein Antrag alle 3 Jahre zulässig, was dann die „Verschärfung der Kriterien“ sein soll. „Die neuen Beitragskriterien sollen die Qualität beim Angebot der Privatzimmervermieter steigern und jungen Unternehmern eine Chance geben“, sagte Arnold Schuler. Scheint ein harter Job zu sein, das Ferienwohnung-Vermieten.
In der jetzt bevorstehenden Neuregelung sollen in touristisch hoch entwickelte Gemeinden wie Gröden, Gadertal, Hochpustertal bei der öffentlichen Förderung des Ferienwohnungsausbaus keine Beiträge mehr gezahlt werden, genauswenig in Bozen. Verdutzt reibt sich der Durchschnittssüdtiroler, der hohe Wohnungsmiete zahlt oder Darlehensraten für die Eigentumswohnung abstottert, die Augen: die Eigentümer von Ferienwohnungen, die immer mehr auch über AirBnB und ähnliche Portale lukrativ vermietet, erhalten einen Beitrag zum Ausbau ihrer Immobilien von bis zu 40.000 Euro, um damit Wohnungen dem Mietwohnungsmarkt zugunsten von Touristen zu entziehen? Die Betreiber eines ohnehin florierenden Erwerbszweigs (Ferienwohnungsvermietung) werden vom Land großzügig gefördert? „Betriebe“ (die Wohnungsbesitzer) werden eigentumsrechtlich aufgesplittet, damit mehrere Fördertöpfe angezapft werden können, was anscheinend bei Bauern häufiger der Fall ist? Echt jetzt?
Einen schon vor der COVID-Krise boomenden Erwerbszweig öffentlich zu bezuschussen, macht weder umweltpolitisch noch sozialpolitisch Sinn. Die Beiträge werden in der Regel „mitgenommen“, fließen also an Eigentümer, die die Investition ohnehin getätigt hätten. Bei den derzeit minimalen Bankzinsen könnten diese Unternehmer den Ausbau von Ferienwohnungen locker kreditfinanzieren. Das Land fördert mit dem Ferienwohnungsbau, dass noch mehr Kubatur in die Landschaft gestellt wird. Schließlich wird gezielt gefördert, wer an Touristen vermietet, nicht an einheimische Dauermieterinnen. Warum schüttet das Land dann nicht Beiträge an jene Wohnungsbesitzer aus, die eine zweite Wohnung zum Landesmietzins an Einheimische auf Dauer vermieten?
In Südtirol lässt sich Längerem eine steigende Vermögenskonzentration beobachten. Verschiedene manchmal schwer zu durchschauende Verteilungsmechanismen fördern diesen Prozess. Schon Vermögende mit Verlustbeiträgen für Ferienwohnungsausbau zu fördern, gehört auch zu diesen Mechanismen.
SALTO, 3.10.2020
Gesetzesvorschlag
Habitate rettenDie Artenvielfalt geht in Südtirol ständig zurück, auch weil laufend Habitate zerstört werden. Die Grünen wollen dem mit einer Gesetzesverschärfung Einhalt gebieten.
Habitate sind Kleinstandorte mit funktionalen Pflanzen- und Tiergesellschaften. Verschwinden Habitate, verschwinden auch die dort lebenden Tiere und Pflanzen. In Südtirol sind heute mindestens 40% der Pflanzenarten gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht. Deshalb müssen noch bestehende Habitate geschützt werden.
Doch in den letzten zwei Jahrzehnten sind mehrere tausend schützenswerte Habitate vernichtet worden, vor allem auf dem Weg der sog. Bagatelleingriffe, die nur vom Bürgermeister zu genehmigen sind. Allein der frühere Sarntaler Bürgermeister Franz Locher soll sich gerühmt haben, in seiner Amtszeit 3000 solcher Eingriffe genehmigt zu haben. Entsprechend „aufgeräumt“ sieht das Sarntal heute aus.
Das Landesnaturschutzgesetz Nr.6/2010 hat diese Zerstörung nur unzureichend gebremst. Die dort aufgeführten Habitate befinden sich meist im landwirtschaftlichen Grün und dürfen als solche genutzt werden. Doch durch die Beweidung und Nutzung für Pferde und Rinder werden die Habitate stark belastet, obwohl ihr Futterwert nur sehr gering ist.
Die Grünen plädieren deshalb im Rahmen eines Gesetzesvorschlags dafür, wirksameren Schutz zu garantieren, indem die Habitate zeitweilig oder permanent umzäunt werden. Sie müssen auch eine Mindestgröße erreichen, um ihre Schutzfunktion überhaupt zu erreichen.
Jeder, der aufmerksam durch die Südtiroler Landschaft geht, merkt, wie sie von den Bauern immer mehr „ausgeräumt“ wird. Jeder noch so kleine naturbelassene Restwald, Hecke oder Gebüsch wird im Namen der Produktivität und mit dem Segen von willfährigen Bürgermeistern geopfert, ganz zu schweigen von den großflächigen „Meliorierungen“. Zu Recht verlangen die Grünen die Einschränkung dieser „geringfügigen Eingriffe“. Nach zwei Jahrzehnten schlechter Erfahrungen wäre es am besten, die Genehmigungsinstanz für solche Eingriffe von den Bürgermeistern wieder zur Landesverwaltung zurück zu verlagern.
SALTO, 20.2.21
Volksabstimmung
Für eine pestizidfreie LandwirtschaftIm kommenden Juni werden die Schweizer über ein weitreichendes Verbot von Pestiziden in der Landwirtschaft abstimmen. Und Südtirol?
Am 13. Juni 2021 könnte die Schweizer Wählerschaft dafür sorgen, dass es in der Landwirtschaft zu einer Umwälzung kommt. Wenn die Volksinitiative „Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide“ angenommen wird, müssten viele Bauern ihren Betrieb neu ausrichten, der heute Böden, Trinkwasser und Artenvielfalt schadet. Die Pestizidverbots-Initiative fordert ein Verbot synthetischer Pflanzenschutzmittel in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege. Das gilt auch bei Importen. Bei einer Annahme würde die Schweiz sozusagen zu einem „Bioland.“ Allein schon für die Argumentation und die Aufmachung lohnt ein Blick in die Kampagnenwebseite: https://lebenstattgift.ch/
Diese Volksinitiative wird vom Schweizer Bauernverband (dem SBB der Schweiz) und vielen weiteren landwirtschaftlichen Organisationen bekämpft. Entschieden gegen die Initiativen wendet sich auch die Lebensmittelindustrie. Diese dürfte nur noch Bio-Produkte verarbeiten, da der Import von konventionellen Produkten verboten würde. In dieser Hinsicht tut sich das Nicht-EU-Mitglied Schweiz leichter, einen eigenen, umweltfreundlichen Weg zu gehen. Zwar warnt der Bauernverband, dass die Umsetzung die WTO-Verpflichtungen der Schweiz verletzen würde, doch hat der Gesetzgeber immer den nötigen Spielraum, dies im Umsetzungsgesetz zu berücksichtigen.
Für die Schweizer Landwirtschaft könnte die Umsetzung der Pestizid- und Trinkwasser-Initiative ein Befreiungsschlag sein. Die Kleinbauern-Vereinigung (VKMB) steht hinter der Volksinitiative für eine pestizidfreie Schweiz. Mit den Promotoren und Umweltschutzverbänden hat sie eine schweizweite Abstimmungskampagne «Zukunft sichern, pestizidfrei produzieren» lanciert. Für die Kleinbäuerinnen ist ein Systemwechsel unabdingbar. «Die industrielle, auf Chemie basierende Landwirtschaft ist nicht mehr zeitgemäß», sagt Regina Fuhrer-Wyss, Präsidentin der VKMB, „Nur mit pestizidfreier Produktion können wir gesunde Lebensmittel, ertragreiche Böden und die nötige Biodiversität bewahren – und damit eine gesunde Schweiz der Zukunft auch für unsere Kinder.“ Für Fuhrer ist klar, dass freiwillige Maßnahmen nicht ausreichen. Sie begrüßt außerdem, dass die Vorgabe auf für importierte Produkte gilt. Die Landwirtschaftsbetriebe und alle anderen Betriebe von Privaten und der öffentlichen Hand, die noch nicht «pestizidfrei» produzieren, erhalten zehn Jahre Zeit für die Umstellung.
Und Südtirol? Das Trentino und Südtirol sind in Italien Spitzenreiter beim Einsatz von Pestiziden. 2018 sind laut einer kürzlich veröffentlichten Studie (Institut Ramazzini). 24,1 kg/ha an Fungiziden ausgebracht worden, 13 kg/ha an Insektiziden und 0,8 kg/ha an Herbiziden. Der gesamtstaatliche Durchschnitt lag wesentlich darunter (3,55 kg/ha an Fungiziden, 0,6 kg/ha an Insektiziden). Auf der anderen Seite erhielten die Südtiroler Obstvermarktungsgenossenschaften EU-Beiträge in großem Stil: 2018 gingen an die VOG 17,05 Mio Euro und an die Vinschger VI.P 8,54 Mio. Euro. Im neuen 7-Jahresprogramm der EU-Agrarpolitik (GAP) hat man es verabsäumt, die EU-Beitragsvergabe strenger an die Reduzierung oder an den Verzicht auf überflüssige Pestizide zu knüpfen. Um die Interessen der Verbraucherinnen und der Bürger allgemein auf gesunde Lebensmittel, auf den Schutz von Artenvielfalt, Wasser und Böden geltend zu machen, steht auch in Südtirol seit Dezember 2018 (LG Nr. 22/2018) der Weg der Volksinitiative offen. „Es gibt weder unüberwindbare technische Hindernisse noch unakzeptable Erträge, die uns daran hindern könnten, bis 2030 eine Schweiz zu erreichen, die absolut frei ist von synthetischen Pestiziden“, schreiben die Schweizer Promotoren. Das gilt genauso für Südtirol. Allein schon die öffentliche Debatte darüber wäre eine Volksinitiative wert.
SALTO, 27.2.2021
Klimaschutz
Schönrechnerei beim KlimaschutzSüdtirol kann bis 2030 Klimaneutralität erreichen, verkündete LH Kompatscher in seiner Haushaltsrede 2020, also 20 Jahre vor der EU als Ganzer. Blickt man 10 Jahre zurück, ist das recht unbegründeter Optimismus.
Der erste echte Klimaschutzplan des Landes, erstellt von hochkarätigen Wissenschaftlern, stammt aus 2011: das strategische Dokument „Energie Südtirol 2050“ bringt nicht nur eine Vision zur Energiewende bis 2050, sondern setzt auch konkrete Ziele und Maßnahmen für die nächsten 40 Jahre. Dabei wird für 2011 von einem Emissionsstand von 5,3 t/pro Kopf ausgegangen. Schon 2016 verkündete der damalige LR Theiner, dass nur mehr 4,4 t CO2-Äquivalente pro Südtiroler emittiert würden. Damit seien die angepeilten 4 t/Kopf für 2020 erreichbar.
Die landeseigene Klimahausagentur stellt das Bild etwas nüchterner dar. Sie errechnete für 2018 7,37 t/Kopf, also etwas mehr als der gesamtitalienische Durchschnitt von 7 t/Kopf. Der Grund: im Klimaplan wird der „graue“ Energieverbrauch einfach ausgeklammert. Man tut so, als importiere Südtirol keine Konsum- und Investitionsgüter, die anderswo mit hohen Emissionen hergestellt und ins Land gekarrt werden. Dieser Bereich stellt in Wahrheit aber den größten Teil der Emissionen dar, erläuterte Andreas Riedl, DfNUS-Geschäftsführer bei der Abschlussveranstaltung der POLITiS-Gespräche „Wachstum neu denken“ am 15.12.2020, „wenn man eine regionale Situation mit nationalen Daten von großen Flächenstaaten vergleicht, vergleicht man Äpfel mit Birnbäumen. Schließt man die grauen Emissionen ein, liegt Südtirol über dem gesamtitalienischen Durchschnitt.“
Wie ist der Stand der Dinge heute? Am 14.12.2019 verkündete LH Kompatscher, Südtirol solle ein „Vorzeige-Klimaland“ werden. Zu diesem Zweck hätte 2020 der Klimaplan „Südtirol Energie 2050“ überarbeitet werden sollen, was nicht gelungen ist. Dennoch gab sich Kompatscher in seiner Haushaltsrede vom 11.12.2020 mehr als optimistisch: „Die wichtigsten Ziele des europäischen Grünen Deals stimmen mit den Zielen, die wir uns in Südtirol gesetzt haben, bestens überein. Es geht darum, die Biodiversität zu schützen, die Kreislaufwirtschaft zu stärken sowie bis 2050 die Netto-Treibhausgasemissionen der EU auf null zu bringen. Südtirol kann dieses Ziel wahrscheinlich schon rund 20 Jahre früher schaffen. Davon bin ich fest überzeugt.“
Ist das realistisch? Woher bezieht Kompatscher diesen Optimismus? Die Fakten sprechen dagegen. Schon im September 2020 hatten die GRÜNEN in einer Landtagsanfrage nach dem Stand der Zielerreichung beim Klimaschutz gefragt. 42 Maßnahmen längs 6 Achsen seien erfolgt, hieß es, nicht alle wirklich relevant für den Klimaschutz. Entscheidend ist aber die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Gegenüber 2011, so LR Vettorato in seiner Antwort, kann man insgesamt von der Einsparung von 0,5 t CO2-Äquivalenten pro Kopf der Bevölkerung ausgehen. Mit anderen Worten: in 9 Jahren hat man nicht mehr als eine halbe Tonne an Emissionssenkung erreicht. Nun will Südtirol in den kommenden 10 Jahren mehr als 6 Tonnen Senkung erreichen, um klimaneutral zu werden? Wohl nur ein frommer Wunsch.
Die nur langsame Elektrifizierung des Verkehrs, die geringe Rate bei der Gebäudesanierung, die fehlende Reduzierung des Transitverkehrs, der allein ein Drittel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen Südtirols ausmacht, das ständige Wachstum des Verbrauchs an Elektroenergie, der Flächenverbrauch: das frisst die Emissionsreduzierung durch mehr Energieeffizienz wieder auf. Man nicht kann auf der einen Seite mobilitätsintensives (Tourismus), emissionsintensives (Landwirtschaft) und flächenverbrauchendes (Raumordnung) Wachstum fördern wie bisher, und auf der anderen Seite in 10 Jahren klimaneutral werden wollen. Auch viel Nachhaltigkeitsrhetorik schafft das nicht.
Und damit zur Klimaplanung selbst: wie angekündigt muss die Klimastrategie 2050 überarbeitet und angepasst werden. Ihre Zwischenziele für 2020 sind weit verfehlt worden. Doch kein Problem, ein Klimaplan ist geduldiges Papier: ein Fachplan des Landes ohne rechtliche Verbindlichkeit, der nicht mal öffentlich näher diskutiert wird. Erreicht man die Ziele, passt’s. Erreicht man sie nicht, schreibt man den Plan halt um und passt die Ziele der Realität an. Sie binden ohnehin niemanden. Der Planansatz selbst sei überholt, unterstrich Andreas Riedl in seinem Referat, top down von den Ämtern vorgegeben, 30 Tage Zeit für Stellungnahmen, doch in der Substanz ohne Beteiligung von Bürgern, Verbänden, Öffentlichkeit. Ohne verbindliche Ziele, kontinuierliches Monitoring und verpflichtende Evaluation durch unabhängige Forschungsinstitute sei das ähnlich wie anderen Landesplänen, die nach Bedarf laufend abgeändert werden. Typische Südtiroler Planungskultur: die Politik will sich alle Türen offen halten. Es gibt keine Klima-Verträglichkeitsprüfung, keinen Umweltanwalt, der Einspruch erheben könnte, wenn Maßnahmen des Landes den Emissionszielen zuwiderlaufen. Wie z.B. wenn das Land ins 972-Millionen-Maßnahmenpaket, das durch den Corona Recovery Fund finanziert wird, einfügt: z.B. die Errichtung von Speicherbecken für die künstliche Beschneiung der Skipisten.
SALTO, 19.12.2020
Corona und die Folgen
Abkehr von der industriellen NutztierhaltungMan weiß schon viel über die Übertragungswege der Corona-Krankheitserreger, kennt die Ursachen für deren Ausbreitung. Doch werden wirklich Lehren daraus gezogen?
Drei Viertel der neuen Krankheitserreger wie SARS, MERS und COVID-19 werden von Tieren auf Menschen übertragen. Vogelgrippe, Schweinegrippe, Nipah-Virus, Ebola, HIV und dergleichen haben zoonotischen Ursprung, springen von Spezies zu Spezies. Das ist seit 20 Jahren bekannt, unterstreicht der Lebensmittelwissenschaftler Kurt Schmidinger, Gründer des Projekts Future Food in einem stark dokumentierten Kurzbeitrag. Jetzt kämpfen wir gegen COVID-19, doch gleichzeitig züchtet die Agrarindustrie die nächsten Pandemien und schafft vielleicht das Ende des Antibiotika-Zeitalters.
Industrielle Nutztierhaltung: ein Virenzuchtsystem
Die in allen Industrieländern praktizierte Massentierhaltung ist speziell in wärmeren Gegenden ein Herd für Krankheitserreger. Kombiniert mit Tiertransporten, grotesken Ernährungsgewohnheiten, Hygienemangel, Kostendruck auf globalisierten Märkten und globaler Mobilität der Menschen schafft man den Raum für neue Pandemien. „Milliarden eingesperrte Tiere produzieren gigantische Menschen an Exkrementen, die große Mengen Pathogene enthalten,“ schreibt Schmidinger, „die werden ins Grundwasser und auf Äcker entsorgt und schaffen eine Infektionsquelle für wildlebende Tiere.“ Wir brauchen nicht, wie Donald Trump, auf die wetmarkets von Wuhan zu zeigen, um von eigenen Fehlern abzulenken. Die hohen Besatzdichten der Tiere, der massenhafte Anfall von Exkrementen und der hohe Antibiotikaeinsatz machen die Massentierhaltung überall problematisch, gleich ob in China, Europa oder Nordamerika.
Antibiotikaresistenz – Die nächste Krise
Es wird geschätzt, dass weltweit 70-80% der Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt werden, der Rest in der Humanmedizin. Die WHO warnte schon vor 10 Jahren, dass in der Nutztierhaltung zwischen 2010 und 2030 der Verbrauch von Antibiotika um 70% ansteigen wird. Die Nutztierhaltung setzt sie als Wachstumsförderer ein: „Die Exposition von Bakterien zu dieser permanenten Gabe von geringen Mengen an Antibiotika begünstigt Anpassungen und Resistenzen der Bakterien“ (Schmidinger). In der Folge schlagen viele Antibiotika bei Fleischkonsumenten nicht mehr an. Das ist nur eines von zahlreichen Risiken der Massentierhaltung, ein weiteres die Verbreitung von Erregern.
Industrielle Tierfarmen sind offen
Nicht nur wetmarkets sind offen, wo Menschen mit Lebendtieren aus Zucht und Wildtieren hantieren. Auch industrielle Tierhaltungen sind in der Realität komplett offen für den Eingang und Ausgang von Krankheitserregern. Schmidinger: „Einerseits kommen Tiere aus anderen Zuchtbetrieben, Brütereien oder Nutztiermärkten sowie Futter und Wasser von außen in die Betriebe. Andererseits verlassen sowohl enorme Mengen Exkremente diese Anlagen, als auch Tiere in Richtung andere Betriebe, Märkte oder Schlachthäuser. Insekten sind weitere Überträger. All das sind Routen für Krankheitserreger zu oder von industriellen Nutztierhaltungen.“
Massentierhaltung oder Epidemien
Die heutige industrielle Nutztierhaltung ist nicht nur für das Ökosystem im Norden (Wasserverschmutzung, Gülle, Futtermittelimport, Nitrateintrag usw), und im Süden (Entwaldung, Monokulturen, Bodenerosion) ein Unheil, nicht nur ein bedeutender Verursacher von klimaschädlichen Gasen und ein völliger Hohn aufs „Tierwohl“. Sie bedroht auch direkt die Gesundheit durch die Begünstigung der Entstehung neuer Krankheitserreger wie COVID-19. Die perverse Haltung von Millionen von Nutztieren ist eine der zentralen Herde dieser und kommender Pandemien. Höchste Zeit daraus zu lernen, nicht nur indem wet markets besser beaufsichtigt werden, sondern indem das weltumspannende System industrieller Fleischproduktion zurückgebaut wird, das für eine gesunde Ernährung gar nicht benötigt wird.
Ein weiterer Lesetipp zum Thema: der hervorragend gestaltete Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung.
SALTO, 20.4.20
Klimaschutz Paris
Die Reichen der reichen Länder zur KasseIn wenigen Tagen geht die Pariser Klimakonferenz zu Ende, ein globales Klimaschutzabkommen ist in greifbarer Nähe, das die Erderwärmung auf 2° im Vergleich mit dem vorindustriellen Zeitalter begrenzen soll. Auf dem Weg zum großen Ziel der „Dekarbonisierung“ der Weltwirtschaft stellen sich nicht nur einige Ölstaaten quer, sondern auch einige Industrie- und Schwellenländer, die für verbindliche Klimaziele nicht zu haben sind wie etwa die USA. Umstritten zudem die Beteiligung der Industrieländer an klimabedingten Schäden sowie an der Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern.
Dass das 2-Grad-Ziel eingehalten wird, ist somit mehr als fraglich. Beim heutigen Trend werden es eher 3° mit unschätzbaren Schäden. Doch produziert auch die inzwischen mit Sicherheit eintretende 2°-Erwärmung in vielen Ländern unabsehbare Schäden. 150 Mrd. $ jährlich werden als Minimum veranschlagt, um die allernötigste Anpassung an den Klimawandel zu finanzieren. Bisher sind allerdings erst 10 Mrd. $ zugesagt worden.
Wenn die reichen Länder diesen Beitrag nicht aufbringen, schrieb Thomas Piketty unlängst in Le Monde, ist es illusorisch, die Schwellenländer und armen Länder für einschneidende Klimaschutzziele zu gewinnen. Indien stellt z.B. 17% der Weltbevölkerung, verursacht aber nur 6% der weltweiten CO2-Emissionen. Größter absoluter CO2-Emittent ist dagegen China, doch pro Kopf liegt auch China mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern noch weit hinter dem Niveau Nordamerikas und Europas. Der etwas geringere Ausstoß von Treibhausgas in Europa erklärt sich daraus, dass wir Europäer massiv aus Schwellenländern importieren und damit Energieverbrauch und CO2-Emissionen einfach auslagern.
Nun ist es zwar legitim zu fordern, dass alle Länder ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten sollen. Doch sind immer noch die reichen Industrieländer die großen Verschmutzer, die nicht von China und den anderen Schwellenländern verlangen können, mehr als jenen Beitrag zu leisten, der ihrem Emissionsanteil entspricht. Man muss also die CO2-Emissionen den Verbraucherländer zurechnen und nicht den Produktionsstandorten. Berücksichtigt man nämlich den Import Europas, der gewaltige CO2-Mengen verursacht, steigt die gesamte von uns Europäern verursachte CO2-Menge um 40%, während jene Chinas um 25% sinkt. Auch die Durchschnittsemissionen einer Tourismus- und Importregion wie Südtirol lägen bei einer solchen Berechnung höher als die aktuell gemessenen 6 Tonnen pro Kopf im Jahr.
In einer aufwändigen Berechnung haben Thomas Piketty und Lucas Chancel die direkten und indirekten Emissionen der letzten 15 Jahre nach Verbrauch und Einkommen aller Länder verursachergerecht zugerechnet und sind zu klaren Schlussfolgerungen gekommen. Die rund 7 Milliarden Menschen emittieren derzeit rund 6 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf im Jahr. Die 3,5 Milliarden Menschen, die weniger energieintensiv leben – also vor allem in Afrika, Südasien und Südostasien – haben einen CO2-Ausstoß von durchschnittlich 2 Tonnen pro Kopf im Jahr. Das summiert sich auf 15% der Gesamtemissionen. Das entgegengesetzte Extrem bilden 70 Millionen Menschen mit dem maximalen Energieverbrauch. Dieses 1% der Erdbevölkerung emittiert 100 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr. Allein diese 70 Millionen sind für 15% der Kohlendioxidemission verantwortlich, also für gleich viel wie die ganze untere Hälfte der Erdbevölkerung.
Wo leben diese Großverschmutzer? 57% in Nordamerika, 16% in Europa, 5% in China, 6% in Russland und Nahost. Diese Daten könnten den Schlüssel für die Verteilung der Finanzlast für den Weltfonds für die Anpassung an den Klimawandel sein (150 Mrd. $ Mindestdotierung). Nordamerika müsste demnach 85 Mrd. $ beisteuern, was immer erst 0,5% seines BIP ausmachte, und Europa 24 Mrd. $ (0,2% seines BIP). Thomas Piketty schlägt konsequenterweise eine Art progressive CO2-Emissionssteuer vor. Man kann nicht von jenen denselben Beitrag zum Klimaschutz verlangen, die zwei Tonnen CO2 ausstoßen wie von jenen, die 100 Tonnen CO2 produzieren. Eine progressive EU-weite Vermögenssteuer (Klimaschutzabgabe) wäre ein Schritt in diese Richtung.
SALTO, Mai 2020
Jetzt online
Ein Muss nicht nur für Fleischesser: der FleischatlasEin grundlegender Wandel im Konsum von Tieren für den menschlichen Verzehr ist angesagt. Warum und wie, das bringt der neue „Fleischatlas“ der Böll-Stiftung in eindrucksvoller Prägnanz.
Um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen und die Ökosysteme der Welt zu schützen, muss der Konsum von Fleisch, Milch und Käse reduziert werden. Dies gilt vor allem für die Industrieländern – dort, wo die Menschen besonders viel konsumieren (im Schnitt 68,6 Kg pro Kopf im Jahr). Die Transformation hin zu einer stärker pflanzenbetonten Ernährung ist eine gewaltige Herausforderung, aber in keinem Industrieland ist bisher ein größerer Rückgang des Konsums zu beobachten. So hat sich in Deutschland zwar der Fleischverzehr seit 1991 um sieben Prozent reduziert. Den klimawissenschaftlichen Empfehlungen zufolge sollten im Durchschnitt nur bis zu 15 Kilogramm pro Kopf und Jahr gegessen werden und nicht knapp 60 kg wie derzeit.
Ohne solchen Kurswechsel wird die weltweite Fleischproduktion bis zum Jahr 2029 noch einmal um 40 Mio. Tonnen auf dann mehr als 360 Mio. Tonnen zulegen, wie die Heinrich-Böll-Stiftung errechnet hat. Die Folgen kann man sich kaum vorstellen, weil die ökologischen Grenzen des Planeten längst schon überschritten sind. Es ist schon lange bekannt: Die industrielle Fleischproduktion befeuert die Klimakrise, Waldrodungen, Pestizideinsatz, den Wasser- und Flächenverbrauch und Biodiversitätsverluste, vertreibt Menschen von ihrem Land. Hier die Darstellung der Wirkung der Halbierung des Fleischkonsums aus dem Fleischatlas.
In Südtirol wird argumentiert, dass es keine Massentierhaltung gäbe. Doch der Pro-Kopf-Fleischkonsum der Südtiroler liegt im gesamtitalienischen Durschnitt bei gut 60 kg im Jahr pro Kopf. Der hohe Fleischverbrauch der Inländer, der fleischintensive Tourismus, die florierende Speckindustrie machen uns zum Teil der Geschäftskette. Dieses Niveau an Tierkonsum geht weder mit Klimaschutz noch mit Tierwohl und auch nicht mit dem Schutz vor gefährlichen Krankheitserreger zusammen, die über Zoonosen auslösen.
Wenn diese Erkenntnisse seitens der Wissenschaft längst vorliegen, warum reagiert die Politik nicht darauf und fährt den bisherigen Kurs z.B. mit dem neuen Programm der EU-Agrarpolitik weiter wie bisher? Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, beugt sich den Lobbys, reagiert aber auch auf den Druck von unten, von den Verbrauchern und der Bevölkerung. Die Politik beruft sich auf die Freiheit der Konsumenten, in deren Präferenzen die Politik nicht einzugreifen hat. Doch die Kultur des Tierkonsums ist nicht so frei gewachsen, wie behauptet wird. Einen Beitrag zur kritischen Haltung beim Tierkonsum hat der vor 8 Jahren erstmals erschienene „Fleischatlas“ der Heinrich-Böll-Stiftung geliefert. Jetzt ist er gründlich überarbeitet worden und im Januar 2021 neu erschienen. Der Atlas ist im Kern eine Sammlung von Infografiken mit klar erläuterten Daten und Fakten. In keiner Publikation zum Thema werden die Machenschaften rund um die Fleischwirtschaft so kompakt und doch so anschaulich dargestellt. Die Publikation bringt auch für Kenner der Materie interessante neue Aspekte. Ein Beispiel: wussten Sie, dass im Zuge von Tierproduktion und –konsum in Deutschland jährlich 8,9 Millionen Tiere (Abfall in ganze Tiere umgerechnet) weggeworfen werden? Aber auch für jeden Fleischesser, der solche Zusammenhänge noch nicht wahrgenommen hat, ist der Fleischatlas ein Muss.
SALTO, 7.2.2021
Tofu statt Speck
Was tun gegen die nächsten Viren?
Ist Ihnen das Borna-Virus bekannt? Unter anderen sind Eichhörnchenzüchter und Katzenbesitzer daran verstorben, aber bisher halt nur wenige. Schon bedrohlicher war die Entdeckung einer mutierten Form des Corona-Virus in dänischen Nerzfarmen. 15 Millionen Tiere mussten kurzerhand vernichtet werden, deren Kadaver jetzt wieder exhumiert wurden, weil sie das Grundwasser verseuchen könnten. Andere Viren lauern schon, die die nächste Pandemie auslösen könnten, wie das Schweine-Corona-Virus SADS-CoV. Eine Studie des UN-Umweltprogramms hat nachgewiesen, dass es auch menschliche Zellen infizieren kann. Und damit sind wir beim Schlüsselvorgang für die laufende Pandemie, der Zoonose. Dass laufend Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden – Ebola, SARS, HIV, West-Nil-Fieber usw. – war bekannt, doch erst seit Corona ist bekannt geworden, dass gut drei Viertel aller neu beim Menschen auftauchenden Krankheitserreger zoonotisch sind.Wenn die Zoonose derartige Folgen hat, reicht es denn bei der Vorbeugung bloß einige Wildtiermärkte in China zu schließen? Oder muss doch dort eingegriffen werden, wo die nächsten neuartigen Viren längst schon brüten? Wie in Dänemark ersichtlich ist die ideale Brutstätte der Viren die industrielle Nutztierhaltung. Der österreichische Lebensmittelwissenschaftler Kurt Schmidinger von futurefood.org nennt sechs Faktoren, die moderne Tierfabriken zu Epizentren für Pandemien werden lassen. Entgegen den Behauptungen der Tierfabriksbetreiber sind ihre Großfarmen offen und durchlässig wie ein Scheunentor. Millionen Tiere bewegen sich aus und ein, dazu Personen, Futter, Abwasser, Mist, Insekten, Abluft – alles kann die Viren nach außen tragen. In der Massentierhaltung erfolgt das genaue Gegenteil des „Abstandhaltens“. Zigtausende auf kleinstem Raum zusammengezwängte Schweine, Kälber, Hühner und Nerze bilden ideale Bedingungen für die Verbreitung. Bevor die Tiere am Virus sterben, haben sie einige hundert andere daneben angesteckt. Warum keult man sonst gleich alle 15 Millionen Nerze in Dänemark? Am Ende verlassen alle virenbelasteten Tiere die Tierfabriken. Der virenbelastete Feinstaub infiziert das Personal und dringt nach außen. Millionen Tonnen Exkremente landen auf den Feldern und infizieren andere Lebewesen. Wenn es, abgesehen von infizierten Menschen, Virenschleudern gibt, dann ist es die industrielle Massentierhaltung.
An diesem Punkt kann es schon irritieren, dass die Regierungen im Zuge der Seuchenbekämpfung Milliarden Dollar (weltweit: Billionen) in die Hand nehmen, um das Gesundheitswesen aufzurüsten, die Bevölkerung durchzuimpfen und die Wirtschaftskrise zu bewältigen, aber nichts wirklich gegen die Massentierhaltung unternehmen. In Deutschland „leben“ Millionen Schweine in Kastenständen mit 65 x 200 cm: die arme Sau kann sich nicht umdrehen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil davon verwandelt sich anschließend in Südtiroler Speck. Nun hat man ihnen mit einer Übergangszeit von 8 Jahren einige Zentimeter mehr Platz und eine kürzere Dauer des Kastenstands zugestanden. Soll das die Viren bremsen?
In Südtirol wird argumentiert, dass es hier keine Massentierhaltung gäbe. Doch importiert Südtirol 70 Millionen kg Fleisch im Jahr, wovon die Hälfte in die Speckherstellung wandert (FF Nr.27/2020). Der hohe Fleischverbrauch der Inländer, der fleischintensive Tourismus, die florierende Speckindustrie machen uns zum Teil der Geschäftskette. Dieses Niveau an Tierkonsum geht weder mit Nachhaltigkeit noch mit Klimaschutz noch mit Tierwohl und auch nicht mit dem Schutz vor gefährlichen Krankheitserregern zusammen. Dann ist es nur mehr kurios, wenn die steuerfinanzierte IDM in einem Spot Südtirol als „nachhaltigsten Lebensraum Europas“ bewirbt, und in der nächsten Anzeige den Südtiroler Qualitätsspeck preist, denn Speckproduktion im heutigen Stil geht gar nicht ohne Massentierhaltung.
Zugespitzt: es muss nicht Tofu sein, aber weniger Tierkonsum schont nicht nur Millionen von Tieren, vermeidet klimaschädliche Treibhausgase und fördert unsere Gesundheit, sondern schützt auch vor den nächsten zoonotisch übertragenen Viren. Das wäre doch ein Grund zum Handeln, oder?
Erschienen auf SALTO, 2.6.2020
Studie der UNEP: https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/medizin/neuer-schweine-coronavirus-sads-cov-infiziert-auch-menschliche-zellen-13374229?fbclid=IwAR2o70BJDxq8RSNNR8h0xw2eXWnwYx30EHY19OhwD_-Nb4YastsoxCjEAQs
Artikel von Kurt Schmidinger auf: www.futurefood.org
Frankreich
Klima-Bürgerrat löst drei Referenden ausTempolimit auf Autobahnen, keine neuen Flughäfen, Gebäudesanierung bis 2040, Kampf gegen Pestizidmissbrauch und 145 starke Vorschläge mehr: der von Macron einberufene Bürgerrat gibt dem Kampf gegen den Klimawandel einen Riesenschub.
Präsident Macron hatte den Klima-Bürgerrat (Convention Citoyenne pour le Climat) 2019 nach Protesten u.a. gegen die von ihm geplante CO2-Steuer einberufen. Die 150 Teilnehmer waren zufällig aus allen Regionen Frankreichs ausgelost worden. Die Mitglieder spiegelten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung und Migrationshintergrund die Gesamtbevölkerung wider. Von Oktober 2019 bis Juni 2020 trafen sich die 150 Ausgelosten an sieben Wochenenden, unterstützt von Fachleuten unterstützt. Beim letzten Treffen vom 19. - 21. Juni 2020 beschloss der Klima-Bürgerrat 149 Empfehlungen. Dieses 500-seitige Bürgergutachten umfasst weitreichende Vorschläge für Wirtschaft, Verkehr, Wohnen, Handel und weitere Bereiche, womit der CO2-Ausstoß Frankreichs bis 2030 um 40 Prozent reduziert werden soll. Schon eine Art Blaupause für ähnliche Programme in anderen Ländern.
Für nachhaltige Mobilität
Mehrere andere Maßnahmen sollen die private Nutzung von Autos verringern. Hierzu gehören Tempolimits auf Autobahnen von 130 auf 110 km/h und die Förderung nachhaltiger Mobilität wie ein ökologisches Bonus-Malus-System für Autos. Weiterhin sollen Beihilfen für ein langfristiges Leasing und zinslose Darlehen für den Kauf sauberer Fahrzeuge ausgebaut werden. Ab 2025 soll der Verkauf von Neufahrzeugen mit hohen Emissionen verboten und die umweltschädlichsten Fahrzeuge aus den Stadtzentren verbannt werden. Generell soll möglichst viel Verkehr von der Straße auf Schiene und Wasser verlegt werden. Auf allen Ebenen sollen zufällig geloste Bürgerräte Einfluss auf Verkehrsplanungen nehmen. Der neuer Flughäfen und Ausbau bestehender Flughäfen soll verboten werden wie Inlandsflüge, wenn es hierzu Alternativen gibt. Auf Kerosin soll eine Steuer erhoben werden.
Gebäudesanierung und Landschaftsschutz
Im Bereich Wohnen sollen alle Gebäude bis 2040 energetisch saniert werden. Die Versiegelung von Böden und die Zersiedelung von Landschaften soll eingedämmt werden. Unternehmen sollen CO2-Bilanzen erstellen müssen. Die Reparatur von in Frankreich verkauften und hergestellten Produkten soll ebenso obligatorisch werden wie das Recycling aller Kunststoffgegenstände ab 2023. Der Klima-Bürgerrat empfiehlt die Neuverhandlung des Handelsabkommens CETA. Für Handelsabkommen sollen als Maßstäbe in Zukunft gelten, dass das Vorsorgeprinzip und das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden. Die Nichteinhaltung soll mit Sanktionen bestraft werden können.
Regulierung von Werbung
Auch gegen den „Überkonsum“ hat sich der Bürgerrat etwas einfallen lassen. Werbetafeln in öffentlichen Räumen und die Werbung für Produkte mit einem hohen CO2-Fußabdruck - wie etwa große SUVs – sollen verboten werden. Stark verarbeitete Lebensmittel und der Einsatz von Stickstoffdünger soll besteuert werden, um den Pestizideinsatz bis 2030 zu halbieren. Die gefährlichsten Pestizide sollen bis 2035 verboten werden, genmanipuliertes Saatgut sofort.
„Ökozid“ als Verbrechen
Der Bürgerrat fordert auch den "Ökozid" als Verbrechen ins französische Strafrecht einzufügen. Ökozid bedeutet die Zerstörung der Umwelt durch Umweltverschmutzung im hohen Maß und die Ausrottung eines Volkes in Folge der ökologischen Zerstörung seiner natürlichen Lebensgrundlagen. Dies war bisher rechtlich nicht als Verbrechen gegen die Umwelt angreifbar. Der französische Klima-Bürgerrat empfiehlt auch, den Erhalt der biologischen Vielfalt, der Umwelt und des Kampfes gegen den Klimawandel als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen. Die Präambel soll um die Formulierung ergänzt werden, dass die Anwendung der in der Verfassung verankerten Rechte, Freiheiten und Prinzipien den Erhalt der Umwelt nicht gefährden dürfen.
Drei Referenden
Wie Präsident Macron in seiner Reaktion auf die Ergebnisse des Bürgerrats angekündigt hat, soll über die Ökozid-Frage sowie die Verfassungsänderungen eine Volksabstimmung abgehalten werden. Diese Art von Bürgerrat ist Modell für eine Volksinitiative, die die Südtiroler „Initiative für mehr Demokratie“ zum selben Thema für Südtirol anstrebt.
SALTO, 27.7.2020
Motorrad-Lärmplage
„Die Botschaft hör’ich wohl, allein….“…es fehlt noch der Glaube, dass nach Ankündigungen von LR Alfreider auch konkrete Schritte gegen diese Plage gesetzt werden. Nördlich des Brenners aber sehr wohl.
Da ist zunächst das Bundesland Tirol, wo seit 10. Juni bis zum 31. Oktober bestimmte Straßenabschnitte für besonders laute Motorräder gesperrt sind. Betroffen sind vor allem das Außerfern und der Bezirk Reutte, der vor allem am Wochenende von lauten Horden von Motorradfahrern vor allem aus Deutschland heimgesucht wird. Detaillierte Studien und Lärmmessungen hatten ergeben, dass bestimmte Motorräder zu bestimmten Tagen und Zeiten den für die Anrainer schlimmsten Lärm erzeugen. Da Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht den erwartete Lärmreduktion erbracht hatten, verordnete Landesrätin Felipe Fahrverbote. Dieses gilt für Motorräder mit einem Standgeräusch (Nahfeldpegel) von mehr als 95 Dezibel laut Fahrzeugschein. Die Verordnung wird von der Polizei kontrolliert. Zuwiderhandelnde riskieren 220 Euro Bußgeld. So löblich diese Fahrverbote sind und so sehr sie die Bevölkerung begrüßt, so wenig wird sie bringen, wenn sie nur für kleinere Gebiete ausgelegt sind. Die Lärmfanatiker werden auf ihren Maschinen auf andere Straßen ausweichen, vor allem nach Südtirol.
Einen Schritt weiter geht der Bundesrat Deutschlands. Die Länderkammer hat einen Gesetzesvorschlag eingebracht, mit dem künftig ein Maximalwert von 80 Dezibel (dBA) für Neufahrzeuge gelten soll, etwa die Lautstärke eines vorbeifahrenden LKWs oder Rasenmähers. Bei „gravierenden Lärmüberschreitungen“ soll die Polizei sofort einschreiten können. Verboten werden soll auch das Sounddesign, mit dem die Fahrer den Lärm selbst einstellen können: ja, das gibt es. Der Vorschlag setzt an der richtigen Stelle an, nämlich an der Konstruktion selbst und würd die Hersteller zwingen, den Lärm an der Quelle zu begrenzen. Technisch absolut möglich. Doch stellt sich gleich die Frage: was gilt dann für die 4-5 Millionen Motorräder, die in Deutschland schon im Umlauf sind? In Italien dürfte deren Zahl auch nicht viel geringer liegen.
In Südtirol gibt es dazu erste Stellungnahmen, die überrascht aufhorchen lassen. LR Alfreider begrüßte die Lärmschutzmaßnahmen im Bundesland Tirol als „Schritt in die richtige Richtung“. In einem Morgentelefon auf RAI Südtirol klang Alfreider so, als wolle das Land Südtirol schon bald gegen laute Motorräder einschreiten und zumindest auf den Passstraßen für Lärmschutz sorgen. Obwohl das Problem im Dolomitengebiet schon seit vielen Jahren akut ist, muss aber laut Alfreider erst noch gemessen werden. Daten, Fakten und Expertenanalysen müssten her. Dass die Bevölkerung und ein Großteil der Touristen selbst sich gestört fühlen, reicht nicht. Eine Umfrage im Auftrag der Dolomiten-Anrainerprovinzen hatte nämlich ergeben: 76% nennen die Motorräder als Hauptbelästigung, 66% hätten gegen eine Maut auf Passstraßen nichts eizuwenden.
Auf eine Maut speziell für Motorräder setzt auch der Bürgermister von Pard Karl Bernhard, der seine Gemeinde von der Motorradsoundkulisse Richtung Stilfser Joch entlasten möchte. Genannt werden um die 10 Euro pro Fahrt. Auch diese eine unzureichende, wenn nicht gar illusionäre Maßnahme. Eine Maut zahlen die Motorradfahrer, die ein Dutzend Pässe pro Tag herunterkurbeln, locker und fühlen sich dabei bestätigt, einen ganzen Nationalpark zu verlärmen. Schließlich hat man ja bezahlt.
Fahrverbote sind unumgänglich, weshalb das Land Südtirol unverzüglich die rechtlichen Möglichkeiten dafür prüfen müsste. Die am meisten betroffenen Passstraßen und Passtäler könnten zu „Lärmsanierungsgebieten“ ausgerufen werden, in welchen zwecks Gesundheitsschutz Maschinen ab einer höheren Dezibelemission (70 dBA laut Fahrzeugschein) nicht mehr durchfahren dürfen. Es ist die Mehrheit der Bevölkerung, die bisher diese Lärmplage immer noch schweigend und zu passiv hinnimmt, die endlich lauter werden muss.
SALTO, 19.7.2020
Motorradplage. Mehr Lärmschutz ist möglich
Pünktlich zur Grenzöffnung waren sie wieder zurück: tausende aufheulende Maschinen, die den ganzen Sommer lang Täler und Passstraßen verlärmen. Gibt es eine Therapie dagegen?Während der Phase 1 der Pandemie war es für viele sonst lärmgeplagte Ortschaften wohl erholsam, wenn neben der geringeren Schadstoffbelastung der Luft auch der Lärmpegel gesunken ist. Im Vorher-Nachher-Vergleich wird es jeder hören: Südtirol ist in den letzten Jahren zunehmend verlärmt worden. Die Dezibelspitzen setzen die Motorräder und das zum allergrößten Teil als Freizeitspaß. Die „Corona-Auszeit“ für aus- und inländische Motorradfreaks hat gezeigt: es ginge den meisten Menschen im Land besser ohne diese Lärmexzesse. Eine kleine Minderheit von PS, Lärm und Geschwindigkeit Besessenen belästigt die große Mehrheit der Bevölkerung.
Südtirol leidet unter dieser Art von Lärmbelastung in besonderem Maß, weil wir von den Ballungszentren in Norditalien und Süddeutschland so gut und schnell erreichbar sind und die gut ausgebaute Infrastruktur fast immer mautfrei und rund um die Uhr genutzt werden kann. Die Lärmverschmutzung betrifft vor allem Täler mit attraktiven Passstraßen, manche davon wie der Mendelpass, Jaufen, Penserjoch und die Dolomitenpässe verwandeln sich an den Wochenenden in Motodrome mit unerträglichem Lärmpegel. Darunter leiden in den Tälern nicht nur die Anrainer, weil sich der Motorradlärm kilometerweit ausdehnt.
Lärmverpestung durch Freizeitverkehr ist aber keine Naturgewalt, und exzessive Lärmproduktion kein Grundrecht. Man hat Lärmschutzwände an Autobahnen und Bahnstrecken gebaut, hat laute Flugzeuge und Motorboote aus dem Verkehr gezogen. Warum nicht strengere Regeln für Motorräder in sensiblen Berggebieten und überlasteten Passtälern? Auch in Südtirol haben die meisten Menschen (und auch Touristen) das Bedürfnis nach Ruhe. Unnötiger Lärm und alpine Motodrome: das passt nicht mehr in eine Zeit, die CO2-Emissionen reduzieren, entschleunigen und die Gesundheit aller schützen will.
Der Sarner Bürgermeister Reichsigl plädierte 2019 für eine Bemautung der Motorräder auf der Penserjochstraße. Das mag ein erster notwendiger Schritt sein, doch rechtlich tun sich dann Probleme mit der Gleichbehandlung aller Motorfahrzeuge auf. Auch Autos können ganz schön Lärm entwickeln. Nur kurze Zeitfenster für die Durchfahrt der lauten Maschinen über die Pässe bis hin zu Sperrungen wären wirksamer. Die heutigen Lärmschutznormen und Emissionsgrenzwerte müssten verschärft und die Polizei in die Lage versetzt werden, diese vor Ort zuverlässig zu messen. Überschreiten die Fahrzeuge durch Manipulation oder Fahrweise die Grenzwerte, müsste die Polizei Strafen einheben oder die Geräte vor Ort stilllegen können. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber auch die Einführung von Frontkennzeichen, damit Motorräder bei Video- und Lärmschutzüberwachung aus der Ferne erfasst werden können.
Lärmgeplagte Regionen könnten Lärmschutzzonen einführen und Fahrzeuge ausschließen, die die Lärmschutzauflagen nicht erfüllen. Unter dem Motto „Laut ist out“ gibt es in Deutschland zahlreiche solche Initiativen gegen Freizeitlärm, insbesondere durch Motorradverkehr in Erholungsgebieten. In einzelnen Fällen sind Lärmsanierungsgebiete eingeführt worden und Nordrhein-Westfalen überlegt gerade gesetzliche Maßnahmen. Ein staatliches Lärmschutzgesetz müsste derartige Einschränkungen für sensible Zonen wie z.B. Naturschutzgebiete und Alpentäler erlauben. Die Regionen müssten die Befugnis erhalten, Lärmsanierungsgebiete auszuweisen, in welchen noch strengere Dezibelgrenzen zu gelten hätten oder Motorräder einfach verboten sind.
Geschwindigkeits- und Geräuschkontrollen sind aber nur eine Art Symptombekämpfung, die insgesamt nicht viel bringt, weil es die Frequenz und Masse an Motorrädern ist, die den gesamten Lärmpegel lästig und gesundheitsschädlich werden lässt. Ein gesetzlicher Eingriff an der Quelle ideal: die Hersteller dieser Geräte sollten verpflichtet werden, den Lärm genauso zu dämmen wie es bei PKW und LKW gelungen ist. Somit ist eigentlich der Gesetzgeber gefragt, auf nationaler und europäischer Ebene Maßnahmen zu setzen, um den von Zweirädern erzeugten Lärm zu reduzieren.
Das ist der Punkt: Motorräder müssen wesentlich leiser werden, was technisch leicht möglich ist. Niemand würde heute mehr knatternde Automobile akzeptieren wie vor 100 Jahren. Motorräder dürfen es noch. Die Anforderungen an die Beschaffenheit und den Betrieb von Motorrädern müssen gesetzlich neu definiert werden. Es gibt kein Grundrecht auf mutwilligen Lärm als Freizeitspaß, sehr wohl aber ein Grundrecht auf Gesundheit. Die Politik ist aufgerufen, der Industrie Vorgaben zu machen, nicht nur den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen zu reduzieren, sondern auch die Lärmerzeugung auf ein erträgliches Maß zu bringen.
SALTO, 17.6.2020
Corona und Klimawandel
Die CO2-Steuer jetztDer Neustart der Wirtschaft nach der Pandemie wird in Europa mit Billionen Euro öffentlicher Ausgaben unterstützt. Wenn das auch dem Klimaschutz dienen soll, braucht es die CO2-Steuer jetzt.
Staatsgrenzen sind sowohl für das Virus wie für die Treibhausgase irrelevant. Beide fordern jetzt und in den nächsten Jahren gewaltige Staatsausgaben, beide treffen die ärmeren und schwächeren Gruppen der Gesellschaft härter. Auf keine von beiden hat die internationale Gemeinschaft bisher ausreichend solidarisch und koordiniert reagiert. Der globale Lockdown hat die Weltwirtschaft stärker eingebremst, als in der Finanzkrise 2008/09 geschehen, und ganz nebenbei die Emission von Treibhausgasen deutlich reduziert. Davon zeugt auch der seit drei Monaten fast kondensstreifenfreie Himmel über Südtirol. 2020 sollen laut Schätzungen 8% weniger Treibhausgase in die Luft geblasen werden als 2019. So wird Deutschland überraschenderweise seine Klimaziele für 2020 erreichen. Weltweit ist man den Paris Klimazielen noch kaum näher gekommen. Natürlich sind die Corona-bedingten Einschränkungen von Mobilität und Wirtschaft nicht der sozial verträgliche Weg dorthin. Und die jetzt notstandsbedingte und vorübergehende Reduzierung bringt auch nur 10% der gesamten Emissionsreduzierung, die für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels erforderlich ist.
Zum anderen bewegt sich der Ölpreis derzeit auf einer Talsohle, höchst kontraproduktiv für den Klimaschutz. Damit werden emissionsärmere Energieerzeugung und Energieverbrauch wieder ein Stück uninteressanter. In dieser besonderen Situation käme eine CO2-Bepreisung gerade richtig. Während verschiedene Wirtschaftsverbände angesichts der Pandemie eine Pause in der Klimaschutzpolitik verlangen, ist gerade das Gegenteil gefordert: die Einführung einer nationalen (Italien) oder besser EU-weiten Steuer auf fossile Brennstoffe. Sie würde den Preis dieser Energieträger anheben und in die Investitionen für Wiederaufbau in die erwünschte klimaverträgliche Richtung lenken. Die Investitionen in erneuerbare Energien könnten zentraler Bestandteil aller Pläne der nationalen Regierungen sein, und damit sowohl Wiederaufbau wie Energiewende beschleunigen. Alle Konjunkturpakete für die Zeit nach Corona sollten darauf ausgerichtet sein, neben der Stützung von Beschäftigung und Wirtschaft gleichzeitig auch den Green Deal und den Klimaschutz in der EU insgesamt voranzubringen. Hat nicht die EU-Kommission selbst zugesagt, beim Einsatz der Recovery Fund-Mittel die Klimaziele beachten zu wollen?
Gerade für Italien hätte die CO2-Steuer in der jetzigen Phase klare Vorteile. Die Erlöse dieser Steuer würden dazu beitragen, die gewaltige Erhöhung des Schuldenstands wieder etwas zurückzufahren. Großverbraucher fossiler Energie wie Kohle- und Ölkraftwerke, unrentable Flughäfen und Fluggesellschaften (Alitalia) und marode Stahlwerke (ILVA) müssten nicht mehr mit x Millionen an Steuergeld weitergeschleppt werden. Es wäre ein guter Moment, diese „Steuergeldsenken“ aufzugeben und öffentliche Mittel in zukunftsträchtige Kleinunternehmen und klimaverträgliche Projekte zu stecken. Die meisten Italiener würden die CO2-Steuer gar nicht bemerken, weil sie den Energiepreis nur auf Vorkrisenniveau stabilisieren würde. Italien wäre auch kein Vorreiter. Frankreich besteuert die CO2-Emissionen seit 2002, Finnland seit 1990 und Schweden seit 1991. Slowenien hat neben Estland seit 2002 die umfassendste CO2-Besteuerung der EU.
Eine CO2-Steuer ist nicht nur wirkmächtig für den Klimaschutz, sondern auch marktwirtschaftskonform. Über den Markmechanismus würden Anreize für Haushalte und Unternehmen geschaffen, die Emissionen zu vermindern. Somit ein marktgerechter Modus, energieeffiziente Produktion, Mobilität, Gebäudeheizung zu fördern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Steuer käme zum jetzigen Zeitpunkt richtig, weil erneuerbare Energien dadurch definitiv rentabel werden. Zudem ist die CO2-Steuer so einfach und kostengünstig einzuheben wie die Mineralölsteuer, nämlich direkt bei den Erzeugern und Verteilern. Andere Treibhausgase kann man über die Bemessung ihres CO2-Äquivalents in die Besteuerung miteinbeziehen.
Der jetzt von der Pandemie ausgelöste Wachstumsknick sorgt zwar für eine kurze Entlastung bei der Erderwärmung, insgesamt gesehen ist er gewiss nicht nützlich für die Bekämpfung des Klimawandels. Hunderttausende Opfer, Millionen arbeitsloser und verarmter Menschen, gewaltige soziale Krisen und dürfen keinesfalls mit positiven Nebeneffekten aufs Klima gegengerechnet werden. Doch diese Krise kann sich wiederholen und der Klimawandel wird sich langsamer, aber dauerhafter auswirken. Die Menschen sind sich jetzt der Folgen solcher Krisen stärker bewusst geworden. Deshalb eröffnet sie auch eine Chance: man kann die Latte für den Klimaschutz höher legen und das Wachstum umpolen. Und dafür bildet die Verteuerung der Treibhausgasemissionen über eine CO2-Steuer ein Schlüsselelement.
SALTO 2.6.2020
Manipulative Olympia-Volksbefragung in Tirol
„Soll das das Land Tirol ein selbstbewusstes Angebot für nachhaltige, regional angepasste sowie wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Olympische und parolympische Winterspiele Innsbruck-Tirol 2026 legen?“ So lautet die offizielle Fragestellung der Volksbefragung zur Bewerbung des Bundeslands Tirol für die olympischen Winterspiele 2026. Genauso gut hätte das Land Tirol die Wählerschaft fragen können, ob sie für alle Zeit das Beste und nur das Allerbeste fürs Land tun soll. Kein Wunder, dass sich „Mehr Demokratie“, parteiunabhängige Initiative für eine Stärkung der direkten Demokratie in Österreich, solch dreiste Manipulation nicht bieten lassen will und Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof einlegen wird. In einer laufenden Kampagne sammelt „Mehr Demokratie“ Unterstützungserklärungen unter den wahlberechtigten Tirolern, um diese manipulative Fragestellung anzufechten.Suggestivfragen bei Volksbefragungen kommen immer wieder vor, vor allem wenn diese von oben eingeleitet werden. Diese Erfahrung machte zuletzt die Aktionsgemeinschaft Reischach bei der Abstimmung zum Liftprojekt Ried am Kronplatz. In Österreich sind sie verfassungswidrig. Fragwürdig ist aber auch der zu erwartende Ablauf dieser „Volksbefragung“, denn die Mittelausstattung ist völlig ungleich. Landes- und Stadtregierung wollen über massive Bewerbung den Konsens der Bevölkerung sozusagen erzwingen und haben eine faire Aufteilung der Werbemittel aus öffentlichen Geldern abgelehnt. Eine Mehrheit für solche Megaevents, die naturgemäß nie „ökologisch nachhaltig“ sein können, ist durchaus nicht gesichert. So hatte München vor 10 Jahren seine Bewerbung für die Winterspiele 2018 nach dem Widerstand der Bevölkerung in Oberbayern aufgeben müssen.
Wenn aber Fairness und Chancengerechtigkeit für die Abstimmungsdebatte nicht gewährleistet wird, kann das Abstimmungsergebnis auch keine Legitimität beanspruchen. Mag. Erwin Leitner bemängelt: „In Österreich wird häufig bei Volksbefragungen, die ‚von obe‘ durch eine Regierung angesetzt werden, ohne demokratischen Anstand vorgegangen“, bemängelt der Bundesvorsitzende von Mehr Demokratie Erwin Leitner, „Fairness und Chancengerechtigkeit ist den Regierenden bei Volksbefragungen kein politisches Anliegen. Eine staatliche Volksbefragung ist aber keine Wahl eines Faschingsprinzen. Sie muss mit der nötigen demokratischen Ernsthaftigkeit organisiert werden. Denn sie gilt für alle, selbst wenn das Abstimmungsergebnis einer Volksbefragung nicht verbindlich ist.“
SALTO, 4.10.2017
Spritsteuersenkung im Gespräch
Benzinsteuer senken kontraproduktivJüngst kursierten Gerüchte über Sonderregelungen für Südtirol zur Senkung der Treibstoffabgaben und damit der Spritpreise an den Zapfstellen im ganzen Land, so wie derzeit für Tankstellen in Grenznähe praktiziert. Für die Energieeffizienz und Energieeinsparung wäre dieses Rezept Gift.
Heute ist über 30% des gesamten Energieverbrauchs dem Verkehr anzulasten und noch höher ist sein Anteil an der Emission von Treibhausgasen. Dabei ist gar nicht eingerechnet, dass viele Kurzzeitgäste und Transitfahrzeuge gar nicht in Südtirol tanken und damit gar nicht in die Südtiroler CO2-Bilanz eingehen. Neben dem Strom ist die fossil betrieben Mobilität jener Bereich, wo der Verbrauch wieder seit Jahren steigt, anstatt gemäß Zielen der Klimastrategie des Landes zu sinken. Südtirol ist auch deshalb bei den CO2-Emissionen pro Kopf nicht auf Kurs dieser Strategie, im Gegenteil.
Elektroautos werden mittelfristig die Benzin- und Dieselfahrzeuge nicht verdrängen, deshalb muss der Kraftstoffverbrauch, wenn Klimaziele ernst genommen werden sollen, reduziert und die Antriebe sparsamer werden. Südtirol hat heute schon einen übertrieben hohen Anteil an großhubigen PKW, denn 44,7% der PKW haben über 1600 cc (ASTAT). Zudem hat der PKW-Bestand, für die im Land Besitzsteuer gezahlt wird, von 2008 bis 2013 sprunghaft um über 100.000 zugenommen, weil diese Steuer in Südtirol deutlich geringer liegt als in den übrigen Regionen Italiens. Dies hat wegen einiger Millionen Euro Mehreinnahmen fürs Land nicht nur zur Verärgerung der anderen Regionen geführt, sondern auch zu einem klimapolitisch unsinnigen „PKW-Zulassungstourismus“.
Auch eine Benzinsteuersenkung allein in Südtirol ist nur die übliche Problemverlagerung, denn eine Provinz ist immer die Grenzprovinz. Läge der Benzinpreis bei uns deutlich tiefer, würden tausende Trentiner sich bei uns versorgen; zieht dann das Trentino mit, fahren die Veroneser zum Tanken nach Rovereto. Das kann es doch nicht sein.
Mit einem geringeren Treibstoffpreis, derzeit ohnehin der Fall, entfällt der Anreiz, emissionsärmere Fahrzeuge einzusetzen. Einen Anreiz dafür böten nicht sinkende, sondern steigende Kraftstoffsteuern, aber auch deutlicher nach Verbrauch gestaffelte Autosteuern.
Zu Recht setzt die Strategie „Energie Südtirol 2050“ auf Reduktion der Nachfrage und Energieeffizienz: bis 2020 soll für die Neuwagenflotte ein Limit von 95g CO2/km gelten. Eine Benzinsteuersenkung ist in diesem Sinn nicht nur energiepolitisch, sondern auch finanzpolitisch verkehrt. Zielführender wäre es, dass alle EU-Länder ihre Spritsteuern harmonisieren und ein übertriebenes Preisgefälle verhindern und den Mehrertrag in den aktiven Klimaschutz investieren.
SALTO, 30.1.2015
Gotthardtunnel eröffnet
Gotthardtunnel kann den Brenner entlasten, wenn die Politik willDie heutige Eröffnung des Gotthardtunnels ist ein epochaler Erfolg der Schweizer Verkehrspolitik. Nicht nur die Schweiz wird dadurch entlastet, sondern auch der transalpine Transitverkehr insgesamt nachhaltig beeinflusst. Es öffnen sich neue Chancen, den Umwegverkehr abzubauen.
Die Schweizer werden mit diesem längsten Eisenbahntunnel der Welt einen beträchtlichen Anteil des LKW-Verkehrs über den Gotthard auf die Schiene verlegen können, allerdings zu höheren Gebühren. Das ist ganz im Sinn des Verursacherprinzips, wenn der LKW-Transit gleichermaßen gesteuert werden kann. Für die heutigen Nutzer des Gotthards ist diese Route heute schon der beste, also kürzeste Weg. Anders gesagt: der Gotthard hat fast keinen Umwegverkehr im Unterschied zum Brenner. Das Problem liegt somit darin, dass hunderttausende LKW jährlich einen Umweg wählen, weil die Schweiz eben teurer ist.
Ganz anders sieht dies am Brenner aus, wo laut Jahresbericht „Verkehr in Tirol 2011“ nur 45% des Güter-Transitverkehrs damit den besten Weg nimmt. 2009 waren 27% des Güterverkehrs über den Brenner Umwegverkehr, 28% Mehrwegverkehr. 55% der LKW über den Brenner nehmen für diese Route einen mindestens 60 Km langen Mehrweg in Kauf, weil sie Kosten sparen, auf der anderen Seite aber damit die Umwelt über Gebühr belasten. Würde der LKW-Transit nach dem Bestwegprinzip (kürzeste Route) gelenkt, wie Verkehrsexperte Claudia Campedelli hier aufzeigt, müsste der Gotthardpass 63% mehr Verkehr aufnehmen, der Brenner könnte 29% des heutigen LKW-Verkehrs abgeben.
Mit der heutigen Eröffnung des Gotthard-Tunnels ist erstmals die technische Kapazität vorhanden, einen ganz erheblichen Teil des Brenner-LKW-Transits auf den Bestweg zu lenken, nämlich über die Schweiz und zwar umweltfreundlich auf der Bahn. Das Verlagerungspotenzial ist enorm, denn der Brenner-LKW-Transit könnte allein dadurch um ein Drittel gesenkt werden.
Wird der neue Gotthard-Tunnel diese Verlagerung bewerkstelligen können? Wird dieses Jahrhundertbauwerk eine gesamtalpine Bestweg-Strategie einleiten und dadurch andere Röhren überflüssig machen? Nur wenn die Verkehrspolitik lenkend eingreift, könnte eine solche Rechnung aufgehen, unterstreicht auch Campedelli. Das Verkehrsabkommen EU-Schweiz erlaubt nämlich der Schweiz, den LKW-Verkehr streng zu deckeln und in den Bahntunnel zu zwingen. Genau diese politische Kernvorgabe fehlt heute beim Brennertransit und für den zukünftigen BBT. Wenn der LKW-Transit in ökologisch verträglichem Maß nach Schweizer Muster gedeckelt würde und beim Güterverkehr auf allen zentralalpinen Transitbahnstrecken (Gotthard, Brenner, Tauern) dieselben Kosten und Gebühren pro Kilometer anfielen, würde der Umwegverkehr automatisch reduziert. Bei der Bahn gibt es keine Maut- und Treibkostenvorteile, die heute hunderttausende LKW auf einen Umweg über den Brenner locken.
In einer zwischen den Alpenländern abgestimmten Strategie kann die Bahn kostengünstiger werden, die Bemautung hingegen teurer, um den Frächtern mehr Anreize bieten, den Bestweg zu wählen. Interessant ist dabei, dass mit dem neuen Gotthard-Tunnel die bestehenden Transportkapazitäten über die großen Alpentransversalen leicht ausreichen, um den alpenquerenden Güterverkehr aufzunehmen, und zwar auch ohne BBT. Eine Verkehrspolitik mit Weitblick müsste an die Bestwegstrategie anknüpfen und den Güterverkehr entsprechend lenken. Das wäre ökologisch, aber auch ökonomisch vernünftiger.
SALTO, 1.6.2016
Unterschreibt gegen das Glyphosat!
Am 25. Jänner 2017 ist eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) zum Verbot des Pestizids Glyphosat offiziell bei der EU-Kommission registriert worden. Diese Form eines EU-Volksbegehrens (Massenpetition) soll die EU dazu bewegen, den Mitgliedstaaten ein Verbot für Glyphosat vorzuschlagen, das Zulassungsverfahren für Pestizide zu überarbeiten und EU-weit verbindliche niedrigere Ziele für den Einsatz von Pestiziden festzulegen. Somit haben alle EU-Bürgerinnen ab heute, 7.2.2017, jetzt ein Jahr Zeit, elektronisch ihre Unterschrift unter diese EBI zu setzen. Wenn binnen 6.2.2018 eine Million Unterschriften zusammenkommen, ist die EU-Kommission verpflichtet, innerhalb drei weiterer Monate Stellung zu beziehen. Sie kann allerdings diese EBI auch ablehnen, was sie begründen muss. Auch wenn man eine solche Bürgerinitiative zu keiner Volksabstimmung führt, ist sie allemal ein wichtiger Beitrag, den Druck von unten auf die EU zu erhöhen. Eine EBI zu unterzeichnen ist wirklich einfach (könnte zum Vorbild für die Unterschriftenleistung bei Volksabstimmungsanträgen auf Staats- und Landesebene werden). Am besten gleich unterschreiben!Hier der vollständige Wortlaut der Glyphosat-EBI.
Weitere Infos bei wemove: https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate
Hier der Link zur Unterzeichnung der EBI, wo auch weitere laufende EBIs unterschrieben werden können. Die EBI kann auch über campact hier unterschrieben werden.
Die Bürgerinitiative fürs Glyphosat-Verbot ist von folgenden NROs betrieben worden:
• We Move Europe (WeMove.EU)
• Health and Environment Alliance (HEAL)
• Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
• Greenpeace
• Corporate Europe Observatory (CEO)
• Campact (Deutschland)
• GLOBAL2000 (Friends of the Earth Österreich)
• Skiftet (Schweden)
• Danmarks Naturfredningsforening (Dänemark)
SALTO, 7.2.2017
Pöder zum Flughafenkonzept
„Keine Verantwortung für die Richtigkeit des Konzepts“Dass die Politik sich Gefälligkeitsgutachten bestellt, wenn sie Argumente für angestrebte Vorhaben braucht, ist allbekannt. Dass sich nicht einmal die Gutachter von der Richtigkeit ihrer Projektionen überzeugt geben, ist eher neu.
Im Fall des Flughafenkonzepts der Wiener Consultingfirma ACV wurden Projektionen und Szenarien zur zukünftigen Entwicklung des Flugverkehrs über den erweiterten Flughafen Bozen geliefert: Fluggastzahlen, Flugzeugtypen, Flugfrequenzen, Bilanzentwicklungen. Doch – wie L.Abg. Pöder aufdeckt – stellt die ACV auf den ersten Seiten des Konzepts klar, dass man für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Konzepts keine Verantwortung übernehme. Das Dokument dürfe nicht als Versprechen oder Darstellung des künftigen Zustands gewertet werden. Doch bildet dieses steuerfinanzierte Papier die Grundlage für die Argumentation der Landesregierung für den Flughafenausbau im Hinblick auf die Volksbefragung vom 12.Juni 2016. Man könne nicht erwarten, dass alle Projektionen zu 100% eintreten und Haftungsausschluss sei in diesem Geschäft üblich, schreibt Pöder in seiner Stellungnahme vom 22.4.16, zitiert aber dann den „Hammer“ dieses Haftungsausschlusses des ACV:
´Trotzdem ist anzumerken, dass der Inhalt dieses Dokuments keiner externen Verifizierung
unterzogen wurde. ACV übernimmt für sich, ihre Mitarbeiter oder ihre Vertreter keine Verantwortung, Haftung oder Verpflichtung hinsichtlich der Stellungnahmen, die im Rahmen dieser Präsentation getätigt wurden oder etwaiger Fehler oder dem Unterlassen von Informationen. Außerdem sind die ACV, ihre Mitarbeiter oder Vertreter in Hinblick
auf die Richtigkeit oder die Vollständigkeit des Inhalts des vorliegenden Dokuments nicht zur Verantwortung zu ziehen. Besonders - aber nicht ausschließlich - gilt dies für Prognosen, Annahmen, Projektionen, Schätzungen, Vorhersagen, oder Zielvorgaben, die darin enthalten sind. Folglich darf dieses Dokument nicht als Versprechen oder Darstellung des künftigen Zustands oder der künftigen Leistung gewertet werden. Ist-Daten und Bestandsanalysen und ihre zeitliche Entwicklung, sowie diesbezügliche Stellungnahmen' müssen als Vorhersagen oder Richtlinien für die Zukunft und zukünftige Resultate gewertet werden.´
Die Gutachter gehen also nicht nur auf Distanz zu den eigenen Aussagen, sondern übernehmen auch keine Verantwortung hinsichtlich etwaiger Fehler oder dem Unterlassen von Informationen. Mit anderen Worten: man bringe Prognosen, Schätzungen, Projektionen in gewissem Sinn aufs Geratewohl. Sie könnten stimmen oder auch nicht.
Besonders ´nett´ - laut Pöder - dann auch noch der Abschluss der Haftungsbedingungen:
"Die ACV übernimmt keine Verantwortung für einen etwaigen Verlust, der sich für Dritte ergibt, die sich auf die Ergebnisse des Dokuments, von dem sie über den Kunden unterrichtet wurden, verlassen haben." Schlussfolgerung: Der Steuerzahler nehme womöglich solche Prognosen von teuer vergüteten Fachleuten als bare Münze, stimme bei der Volksbefragung mit JA und zahle dann doppelt: das nicht zutreffende Konzept und die Verluste aus dem Flughafenausbau.
SALTO, 25.4.2016
Verlärmte Passstraßen
Lärmschutzvorschriften generell unzureichendNatur- und Umweltschützer haben im August mit Nachdruck eine zeitweise Schließung der Dolomitenpässe gefordert. Doch kann eine solch partielle Maßnahme gegen die allgemeine Verlärmung der Südtiroler Täler ausreichen?
Wenn man das sommerliche Verkehrschaos rund um den Sellastock eindämmen will, mag eine zeitweise Sperrung der Pässe für den Individualverkehr der erste Schritt sein. Doch die Verlärmung ganzer passführender Täler, Dörfer und Wohngebiete betrifft weit mehr als diese drei Dolomitenpässe. Auch der Jaufen, das Penserjoch, das Timmelsjoch, Stilfserjoch, Mendel- und Gampenpass und Karerpass sind drauf und dran, sich untertags in ein Motodrom zu verwandeln. Würden die Pässe einige Stunden pro Tag geschlossen, verlagerte sich der Verkehr auf andere Zeiten und die Biker-Horden donnern noch früher los. Zudem geht es nicht nur um Täler und Passstraßen. Wohngebiete, Naherholungsgebiete, Haupttäler sind vor allem im Sommer leiden genauso unter einem Lärmteppich.
Der Grund für diese Verlärmung ist nicht nur das schiere Aufkommen des Verkehrs aller Art, sondern auch die Art von Fahrzeugen. Motorräder werden bei Beschleunigung extrem laut, der Lärm breitet sich nach oben aus und hallt von den Bergen zurück. Für diese Art Lärm bieten die geltenden Lärmschutzvorschriften überhaupt keine Handhabe. So schließt das geltende Landesgesetz zum Lärmschutz (Nr.20 vom 5. Dezember 2012) die Lärmbelastung durch einzelne Fahrzeuge aus seinem Anwendungsbereich genauso aus wie Immissionsgrenzwerte für Lärm von Straßen, Eisenbahnen und Flughäfen (Art. 10, Abs.2) aus. Es gibt zwar Lärmkarten, strategische Lärmkarten und Aktionspläne nach staatlichen und europäischen Vorschriften, die Land und Gemeinden zu Schutzmaßnahmen verpflichten, doch bieten sie keinen Zugriff z.B. auf Motorräder, die täglich zu Abertausenden in Südtirol einfallen.
Es geht heute zum einen darum, großflächig strengeren Lärmschutz einzuführen, also niedrigere Immissionswerte festzulegen; zum anderen an der Quelle des Lärms, nämlich den Fahrzeugen anzusetzen. Neue und größere Lärmschutzzonen müssten für zu laute Geräte gesperrt werden, wie das nachts Ortschaften bezüglich der Scooter tun. Damit könnte man besonders laute Fahrzeuge wie etwa hochtourige Motorräder, Sportwagen mit absichtlich lauten Auspuffanlagen, aber auch lautstarke Fluggeräte aus den lärmsensiblen Zonen verbannen.
Dann zu den Fahrzeugen selbst: Heute gelten Lärmgrenzwerte nach Fahrzeugkategorien, die Zulassung erfolgt nach Euroklassen normiert, die Fahrgeräuschprüfung erfolgt nach bestimmten Touren und Geschwindigkeiten. Die Festlegung der Lärm-Grenzwerte und Messmethoden erfolgen bei Geschwindigkeiten unter 80 km/h, darüber gibt es dann nichts mehr. Mehr Lärmschutz an der Quelle wäre technisch möglich, doch gibt es keinen gesetzlichen Zwang dafür. Die Motorradhersteller behaupten, dass man leise Motorräder nicht verkaufen könne. So steht das „Grundrecht“ des Motorradverkaufens und Dröhnens der Biker gegen das Grundrecht auf Gesundheit und Ruhe.
Es geht also längst nicht mehr um einige schwarze Schafe, die das Gas aufdrehen, sondern um echte, wirksame Lärmgrenzwerte für diese Art von Maschinen. Nicht das kaum überprüfbare Fahrverhalten wäre ausschlaggebend für eine Einschränkung, sondern die technische Möglichkeit eines Geräts, bestimmte Dezibel zu emittieren. Wenn die florierende Motorradindustrie Millionen von Bikern ermöglicht, die Alpen zu verlärmen, müssten die Bewohner endlich ihr Recht auf Lärmschutz dagegenhalten. Wenn sich unsere Täler in Motodrome verwandeln, sägt auch der Tourismus am Ast, auf dem er sitzt, denn wer Ruhe und intakte Landschaften bewandern will, verweilt nicht mehr lang in lärmverseuchten Tälern.
SALTO, 24.8.2016
Olympia in Cortina?
Schnapsidee: Winterspiele in CortinaCortina will zusammen mit Mailand die Olympischen Winterspiele 2026 austragen. Mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten ist das nicht vereinbar.
Die Bewerbung des ehemaligen Olympia-Orts Cortina (1956) läuft im Tandem mit Mailand. Südtirol will allenfalls einzelne Wettkämpfe übernehmen wie z.B. die Biathlonrennen in Antholz, ohne neue Infrastrukturen zu bauen und ohne sich an den Gesamtkosten zu beteiligen. Zwar gibt auch Cortina vor, für Olympia 2026 keine neuen Sportstätten bauen zu müssen, doch dieses Megaevent bringt gewaltige Verpflichtungen vor allem bei der Unterbringung mit sich. Fast 3.000 Athleten, etwa 3.000 Trainerinnen, an die 1.000 IOC-Funktionäre sind aufzunehmen. Dazu kommen die Medienleute: in Pyeong Chang 2018 waren es nicht weniger als 14.000, also fast 5 pro Athletin. Dazu kommen das technische Personal und mindestens 15.000 Zuschauer. Da die Zahl der Sportdisziplinen und Athleten tendenziell zunimmt, wird die Zahl der Gäste insgesamt auch nicht abnehmen, nämlich an die 40.000. Jedenfalls rechnet man 2022 in Peking mit einer solchen Zahl, aber Peking ist halt etwas größer als Cortina, das selbst nur knapp 6.000 Einwohner hat.
Das IOC akzeptiert keine Verteilung der Athletinnen auf die Hotellerie der ganzen Umgebung, sondern verlangt eine Art Olympisches Dorf mit überwachtem Zutritt, einheitlichem Standard und allen logistischen Sonderanforderungen. Zudem würden die bestehenden Beherbergungskapazitäten in Cortina allein schon durch die Zuschauer ausgebucht. Das IOC verlangt maximal zwei Austragungsorte, einen für den Bergsport, einen anderen für den Eissport. In diesen „olympischen Dörfern“ müsste dann auch das technische Personal untergebracht werden sowie die Medienleute und Medienzentren. Falls es den Zuschlag erhält, müsste Cortina diese Einrichtungen neu bauen, hinterher würde das Bauvolumen wohl wieder verfallen. Selbst wenn es sich um Fertigbauhütten handelte, die wieder zurückgebaut würden, wäre der Flächen- und Ressourcenverbrauch enorm. Der Bodenverbrauch für diese Zusatzkubatur wäre eine gewaltige Belastung für die Cortineser Landschaft. Die Verkehrsbelastung während der Spiele und hinterher, um die zusätzlichen Betten zu füllen, all das wäre Gift für die ohnehin schon überbelasteten Dolomiten.
Nicht nur Cortina, kein Ort und kein Tal des Dolomitengebiets könnte heute eine derartige Masse an zusätzlichem Bauvolumen verkraften. Eigentlich ist es unverständlich, welcher Teufel – man könnte auch ganz einfach „Gier“ sagen – die Cortinesen reitet, sich um die Ausrichtung dieses Megaevents 2026 zu bewerben. Nicht umsonst haben schon alle anderen zunächst interessierten Alpenregionen wie Oberbayern, Graubünden und Tirol abgelehnt, in Innsbruck erst nachdem sich die Bevölkerung in einer Volksabstimmung quer gelegt hatte. Bei einer Volksabstimmung im Kanton Wallis im Juni 2018 haben sich 53% gegen die finanzielle Unterstützung der Spiele entschieden, wodurch die Kandidatur von Sion/Sitten hinfällig wurde. Am 6. Juli 2018 hat das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) das Kandidaturvorhaben von Graz/Schladming für die Winterspiele 2026 überraschend zurückgezogen. Die Südtiroler Landesregierung war diesmal gut beraten, gleich abzuwinken, wird aber beim eventuellen Zuschlag an Cortina doch mitnaschen wollen.
Ökoinstitute und Umweltverbände aus ganz Venetien lehnen die Bewerbung Cortinas für Olympia 2026 ab als völlig unvereinbar mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten. Selbst wenn keine neuen Sportstätten gebaut würden, ist ein solches Megaevent aus ökologischer Sicht nicht nur für ein UNESCO-Naturerbe unvertretbar. Die Belastung vor und während der Spiele und das zusätzliche Bauvolumen für die Beherbergung wären Gift für die Landschaft. Dazu kommt die zusätzliche Verkehrsbelastung, als ob die Dolomiten nicht schon genug davon hätten. So wie heute vom IOC konzipiert und geregelt sind solche Events überhaupt keiner alpinen Region mehr zumutbar. Unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit sind die Olympischen Spiele als Massenspektakel überhaupt in Frage zu stellen.
SALTO, 2.10.2018
SAD-Vision Dolomitenbahn
Wo die Bahnen in den Himmel wachsen„Es wird die schönste Bahn der Welt“, zitierte Ing. Moroder der SAD-Direktor Vettori am vergangenen Freitag auf der hochkarätig besetzten Verkehrspolitik-Tagung auf Schloss Prösels. Um Visionen ging es, denn Visionen sind zurzeit gefragt, koste es buchstäblich was es wolle.
Es war schlicht und einfach faszinierend wie Ing. Moroder seine Bahntrasse virtuell durch die Dolomiten zog. Anhand von Luftaufnahmen, in die er live die Bahnstrecke hineinsetzte und durch die Landschaft zog, zwischendurch ein Rendering einer Brücke, eines Bahnhofs, eines Tunnels, eine Meisterleistung an Präsentationstechnik. Hut ab. Die 75 Km lange Dolomiten-Bahn startet von Bozen, quert das Seiser Hochplateau, durchfährt Ladinien und erreich Cortina in zwei Stunden und 17 Minuten. Von St. Ulrich klettert sie als Zahnradbahn – und zahlreiche weitere Passagen als Zahnrad – aufs Grödnerjoch, dann über Corvara, Stern, St. Kassian zum Falzarego-Pass und gemächlich runter nach Cortina. Nicht nur Chinesen, Japaner und Inder werden begeistert sein von solch einer Fahrt durch die Dolomiten, Moroders Enthusiasmus steckt an, der Saal ist eine halbe Stunde lang wie gebannt.
Auch wirtschaftlich hat Moroder das Projekt durchgerechnet: 1,6 Milliarden Euro Baukosten, 6,5-7,5 Millionen Fahrgäste im Jahr, bei 22 Mio. Euro Betriebskosten und 18-24 Mio. Euro Einnahmen voraussichtlich Kostendeckung. Im Unterschied zu den übrigen Bahnstrecken Südtirols wäre die neue Dolomitenbahn sogar fast rentabel im Betrieb. Wirtschaftlich rechnen würde sich das Projekt aber vor allem deshalb, so Moroder, weil es auch zusätzlichen Tourismus und BIP und zusätzliche 40 Mio. Euro im Jahr an Steuereinnahmen für das Land einbringen würde, die eben in den Bau fließen müssten.
In der Schweiz gibt es derartige Bahnen seit gut 100 Jahren (die Jungfraujoch-Bahn ist 1903 fertiggestellt worden, der Glacier-Express ist allen ein Begriff) und sind heute Geldmühlen mit 100.000en Gästen aus Übersee. Vielleicht hat dieses Modell für die Dolomitenbahn Pate gestanden. Doch keiner der Diskutanten am Podium fragt: „Brauchen die Dolomiten auch das noch?“ Sind die Millionen Besucher nicht schon genug? Gibt es keine Grenze für alpine Rummelplätze? Natürlich geht es bei diesem Bahn-Megaprojekt auch darum, den heutigen PKW-Verkehr einzudämmen, wird die SAD antworten. Doch kann man den Lärm reduzieren, die Umwelt und Landschaft schonen, sich sanft bewegen auch ohne eine komplett neu in die Landschaft gefräste, 1,6 Mrd. Euro teure Bahntrasse?
Als Vize-Verkehrsminister Nencini zu Wort kommt, gibt er sich beeindruckt. Nebenbei erlaubt er sich auf die näherliegenden gewaltigen Bauvorhaben hinzuweisen, den BBT, die Tunnelumfahrung von Bozen, die Zulaufstrecken des BBT bis Verona, die veralteten Regionalbahnen in Italien. Er spricht vom etwas bescheideneren Dolomiten-Bahnprojekt der Toblach-Cortina-Verbindung. Nur in einem Nebensatz fällt das Stichwort: „Progetti fantasmagorici possono aspettare“.
Dabei war neben der Vision der Dolomiten-Bahn auf dieser Verkehrstagung eine zweite Vision der SAD schon ganz verblasst, die Überetsch-Bahn. Ing. Moroder zeigte den Trassenverlauf zum Einstieg ganz nebenbei: er verläuft fast zur Gänze auf bestehenden Straßen und kostet 200 Millionen, also Peanuts im Vergleich mit der Dolomitenbahn. Was bisher als unüberwindliches Hindernis für diese wirklich dringende Nahverkehrsinfrastruktur galt, nämlich die Kosten, standen plötzlich als reine Nebensache da. Woher nimmt die SAD diese Zuversicht, und woher das Kapital?
Interessant bei dieser Tagung, dass andere Bahnprojekte, die halbfertig in der Schublade liegen und kein UNESCO-Weltnaturerbe mit einer neuen Trasse durchschneiden - die Riggertal-Bahnschleife, die Verbindung der Vinschgerbahn mit dem Schweizer Bahnnetz, der neue Bahnhof Bozen, und eben die noch nicht projektierte BBT-Zulaufstrecke Verona-Bozen - zwar genannt wurden, aber als irgendwie schon finanziert, realisiert und abzuhaken erschienen. Wenn so viel freies Kapital auf Verwertung in Gebirgsbahnen wartet, könnte Nencini freilich auf die Idee kommen, dass Südtirol für die BBT-Zulaufstrecken etwas mehr abzwacken kann als bisher vorgesehen.
Klaus-Peter Dissinger war es schließlich, der zu bedenken gab, dass es noch andere „Visionen“ zu pflegen gilt: etwa den Umwegverkehr über den Brenner von 600.000 LKW im Jahr in die Schweiz auf den Bestweg zu bringen, die Zulaufstrecken mit ihrem enormen Kapitalbedarf rechtzeitig bis 2026 fertigzustellen, Garantien dafür zu schaffen, dass der BBT wirklich den Gütertransit auf die Schiene bekommt, die Warentransitmenge mit ihren unvermeidlichen Transport- und Umweltkosten überhaupt zu reduzieren. Solche Visionen haben freilich weit geringeren Unterhaltungsgrad. Und den Verkehr durch Naturlandschaften – oder was davon übrig ist - insgesamt zu reduzieren, dem Tourismus in einem Weltnaturerbe insgesamt Grenzen zu setzen, vorhandenes Kapital wirklich klimaschutzbewusst einzusetzen, ist schon gar keine Vision mehr. Dabei hatte Moroder abschließend sein Projekt sogar in diesen Zusammenhang gestellt, nämlich das Klimaschutzabkommen von Paris 2015. Doch geht Klimaschutz auch ohne 1,6 Mrd. Euro teure neue Bahntrasse mit 7,5 Mio. Fahrgästen im Jahr quer durchs UNESCO-Naturerbe?
PS: In diesem brillanten Projekt wird Plan de Gralba mit Bozen mit einer komplett neuen Bahntrasse verbunden, die laut SAD-Projektion für sich genommen die Kleinigkeit von 900 Mio. Euro kostet. Dabei gibt es noch eine alte Bahntrasse nach Gröden, die mit einem Bruchteil davon erneuert werden könnte, wenn man schon auf die Bahn setzt.
SALTO, 31.7.2016
eingutertag.org
Sostenibili giocando
Quale stile di vita ci fa bene? E quale stile di vita è compatibile con la necessità di stabilire il clima per salvare il pianeta?Un’iniziativa germanica ha trovato una risposta a questa domanda in forma di un gioco, che è anche una piccola scommessa con se stessi (www.eingutertag.org). Noi mangiamo, acquistiamo vestiti, abitiamo in case, d’inverno le riscaldiamo, d’estate le raffreschiamo e di sera le illuminiamo, viaggiamo in treno, bus e auto – il nostro stile di vita produce direttamente e indirettamente CO2. Ogni persona può emettere un massimo di 6,8 chili di CO2 al giorno, affinché il riscaldamento climatico si mantenga al di sotto dei due gradi. Per raggiungere gli obiettivi di protezione del clima stabiliti dalla comunità internazionale nel quadro della COP21 a Parigi è necessario adottare uno stile di vita diverso. È un cambiamento attuabile?
La CIPRA, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha ripreso l’idea ribattezzandola “100max – il gioco alpino per proteggere il clima”, perché una buona giornata ha a disposizione un massimo di 100 punti. Con questo “gioco” una settantina di nuclei familiari da città e comuni dei sette Stati alpini sperimentano stili di vita rispettosi del clima. Le circa 70 famiglie partecipanti cercheranno per una settimana nel marzo e nel giugno 2016 di vivere in modo rispettoso del clima. Per una settimana a marzo e una settimana a giugno questi partecipanti documentano tutto quello che consumano, gli abiti che indossano e come viaggiano. Così possono sperimentare se e come riescono a vivere con 6,8 chilogrammi di CO2. Sul sito www.eingutertag.org possono vedere come se la cavano le altre famiglie in Francia, in Slovenia o in Svizzera, e come e dove si possono risparmiare punti. Per il Sudtirolo partecipa anche la città di Merano. L’obiettivo del progetto è stimolare una riflessione sulle proprie abitudini di consumo e promuovere la sperimentazione di uno stile di vita sostenibile. «Vogliamo promuovere la consapevolezza che per una protezione del clima effettiva sono necessarie condizioni politiche e allo stesso tempo l’impegno di ogni singola persona», afferma Claire Simon, direttrice di CIPRA International.
Alla conclusione del progetto, nell’ottobre 2016, delegazioni di tutti i comuni partecipanti si incontreranno alla Settimana Alpina a Grassau in Germania. In tale occasione si terrà anche una conferenza dei ministri dell’ambiente dei sette Stati alpini, in cui si getteranno le basi per la cooperazione a medio termine nello sviluppo sostenibile tra Italia, Austria, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera. Le esperienze ottenute da 100max saranno presentate ai decisori partecipanti alla Settimana Alpina, comunica la CIPRA.
Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili su www.100max.org e su www.cipra.org
SALTO, 10.2.2016
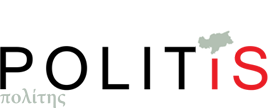
![[[Slogan]]](img/logo_slogan.png)

